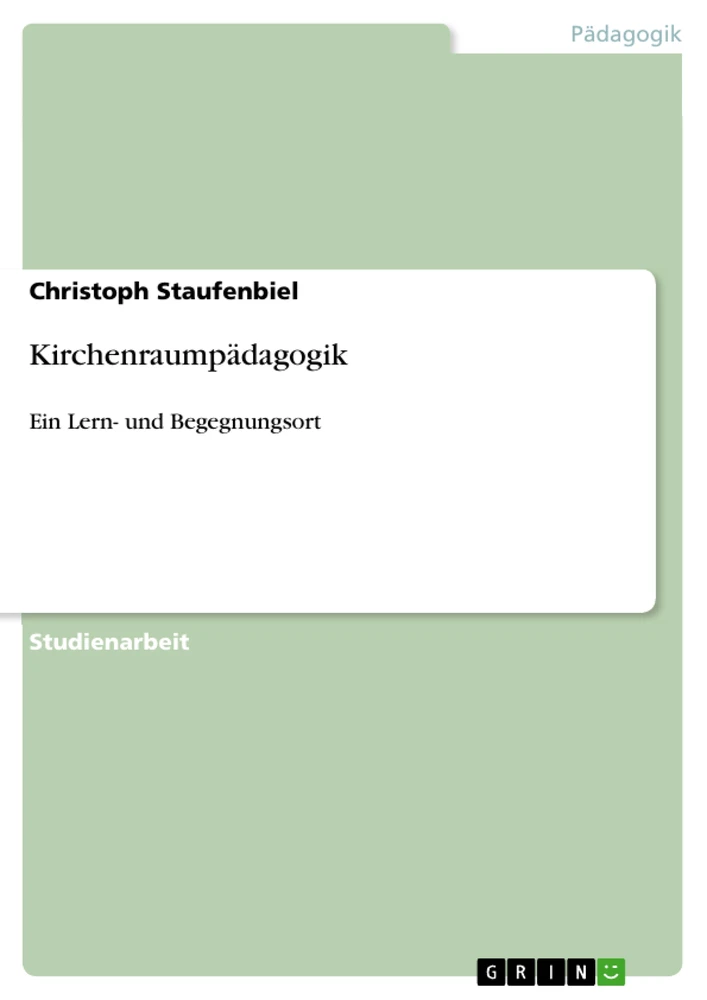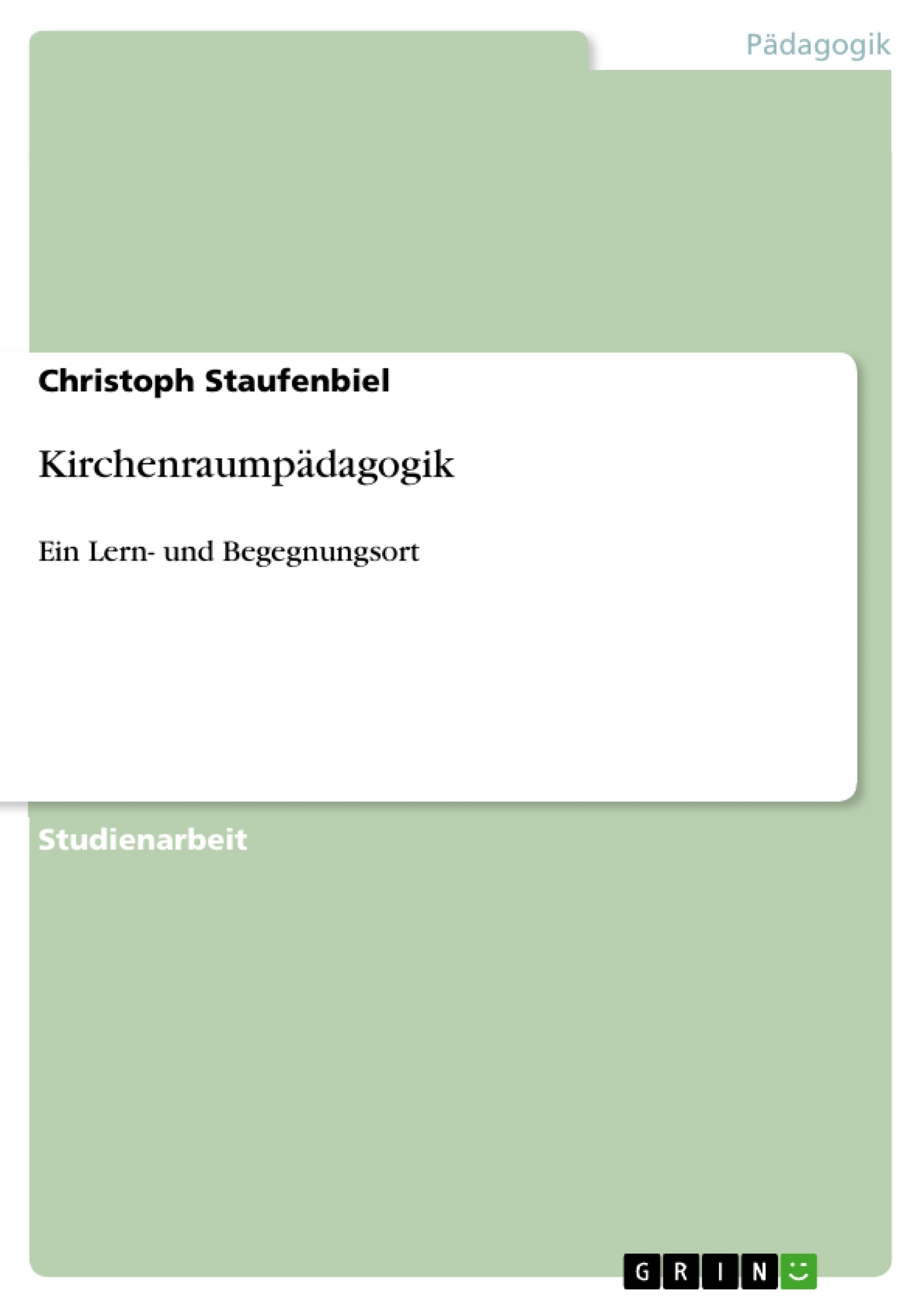1 Einleitung
Für viele Menschen ist die Kirche ein befremdlicher Ort und was in den heiligen Räumlichkeiten geschieht bleibt daher ebenfalls fremd. Vor allem sind die Jugendlichen kaum mit der Kirche als Ort und somit der christlichen Religion vertraut. Ihnen fehlt es wie so häufig an Kenntnissen und Erfahrung.
Aufgrund der heterogenen, multikulturellen Gesellschaft in Deutschland ist es daher ganz besonders erforderlich die jungen Schüler an kulturelle Kontexte der Weltreligionen heranzuführen, um ihnen diese verständlich, greifbar und zugänglich zu machen.
Die Kirchenraumpädagogik soll daher eine Brücke zu den Jugendlichen und der Kirche herstellen. Sie ermöglicht einen interessanten Zugang zu etwas Neuem und Unbekanntem. Dies wird erreicht durch unterschiedliche Herangehensweisen, die methodisch und didaktisch aufgearbeitet werden können. Es geht dabei nicht ums Bekehren.
Vielmehr geht es um das Verstehen und das Kennenlernen, um eine Erfahrung die durch alle Sinne gemacht und aufgenommen werden kann. Kirchenraumpädagogik ermöglicht es den Schülern sich zu orientieren und sich heranzutasten an das Unbekannte. Wichtig ist dabei eine offene innere Einstellung und Haltung, um die Aura der Kirche als einen besonderen Raum wahrzunehmen und zu spüren. ..........
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Theoretische Grundlagen
2.1 Kirchenraumpädagogik oder Kirchenpädagogik?
2.2 Die Kirche als ein besonderer Raum
2.3 Entstehungshintergrund der Kirchenraumpädagogik – Ein kurzer Einblick
2.4 Ziele der Kirchenraumpädagogik
3 Durchführungsphasen der Kirchenraumpädagogik – Eine didaktisch- methodische H Herangehensweise
3.1 Organisatorische Vorüberlegungen
3.2 Phase der Eröffnung und der Annährung
3.2.1 Phase des Verweilens und des Entdeckens
3.2.2 Phase der Verdichtung und der Vertiefung
3.2.3 Phase der Rückkehr und der Ablösung
3.3 Systematisierende Leitschritte der vier Phasen
3.4 Mögliche Unterrichtsziele
3.5 Auswahl der Methoden und Sozialformen
3.6 Lebensbezug als Schlüssel zur Interessenweckung
4 Fazit
5 Literatur- und Quellenverzeichnis