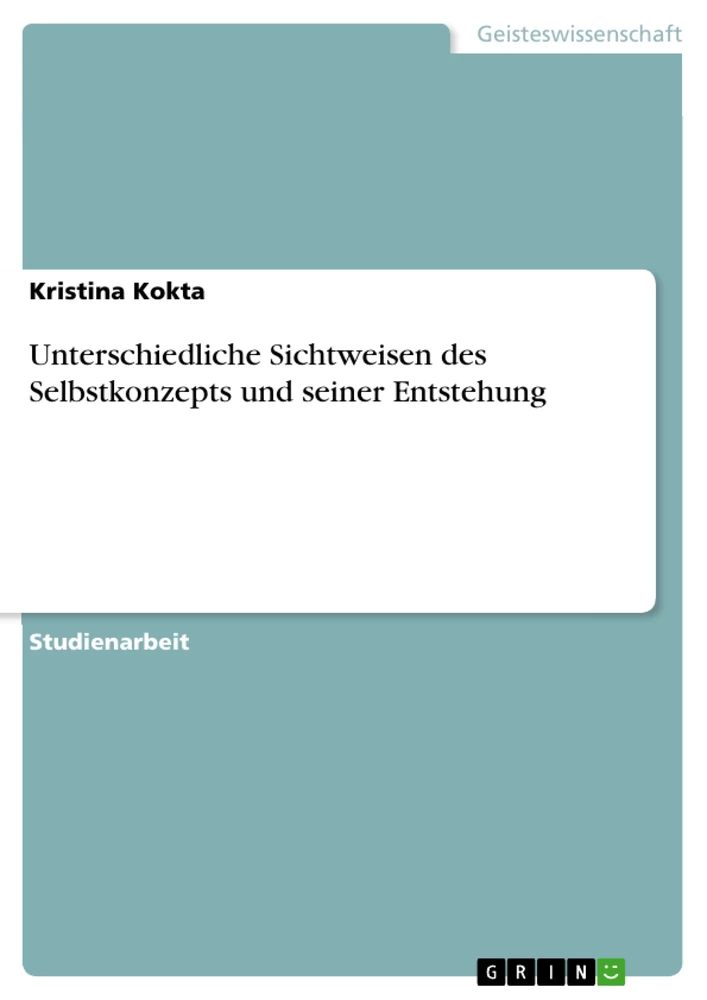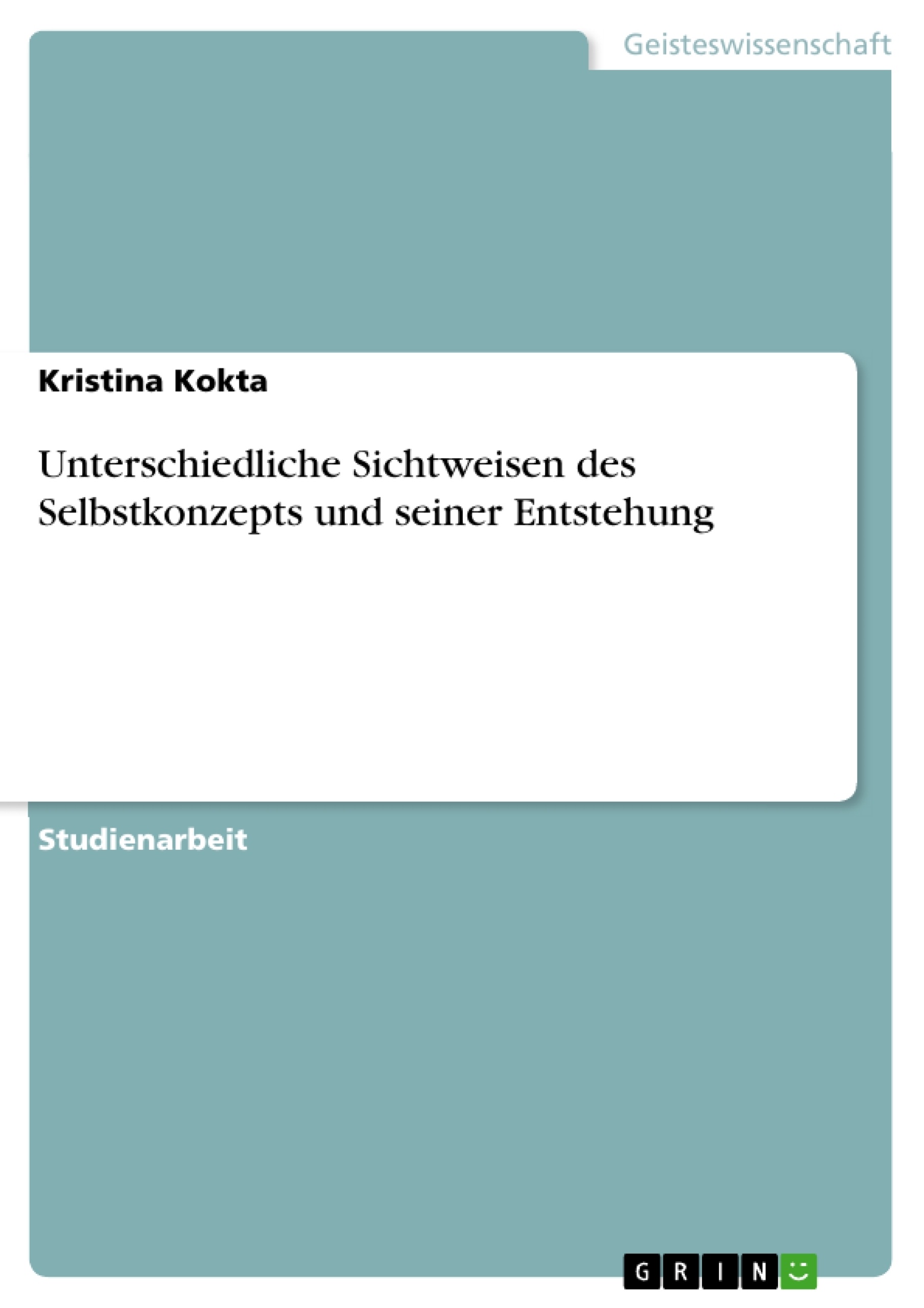Meine dieser Seminararbeit zugrunde liegende Forschungsfrage lautet: "Inwiefern lassen sich unterschiedliche Sichtweisen des Selbstkonzeptes und seiner Entstehung ausmachen?" Des Weiteren wird folgende Subfragestellung behandelt: Welche Unterschiede bzw. Gemeinsamkeiten treten hervor, vergleicht man sie mit dem personenzentrierten Konzept der Selbstentwicklung?
Vorangestellt werden sowohl Carl R. Rogers, die personenzentrierte Psychotherapie sowie der Begriff des Selbst/Selbstkonzept einer kurzen Betrachtung unterzogen, um dem Leser1 den Einstieg in die Thematik zu erleichtern. Mittels Literaturrecherche werden sodann Einführungen in die einzelnen Entwicklungstheorien geben und ihre wesentlichen Grundgedanken herausgearbeitet. Da eine Behandlung aller existierenden Theorien zur Entstehung von Selbst und Selbstkonzepten den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde, beschränke ich mich auf die in diesem Seminar erörterten. Demnach folgen Abschnitte über die Entstehungsentwürfe Margaret Mahlers, Daniel Sterns, Eva-Maria Biermann-Ratjens, Martin Dornes' und die Forschungsgruppe um Peter Fonagy sowie Carl Rogers'. Dem Entwicklungskonzept von Rogers wird dabei die größte Aufmerksamkeit gewidmet, da diese Arbeit im Rahmen des Schwerpunktes 'Personenzentrierte Beratung und Psychotherapie' geschrieben wird und in vielen wissenschaftlichen Arbeiten auf sein Modell immer noch Bezug genommen wird. In einem nächsten Kapitel erfolgt eine Gegenüberstellung der behandelten Entwicklungskonzepte und werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Theorien näher erläutert.
Abschließend dient ein Resumé der Zusammenfassung der Erkenntnisse dieser Arbeit und schließe ich die Arbeit mit einigen persönlichen Überlegungen, Gedanken und Einschätzungen.
Inhaltsverzeichnis
0 Einleitung
1 Zum Begriff der / des
1.1...Personenzentrierte Psychotherapie / personenzentrierter Ansatz
1.2...Carl R. Rogers
1.3...Selbst / Selbstkonzept
2 Die psychoanalytische Entwicklungstheorie nach Margaret Mahler
3 Die Phasen des Selbstempfindens bei Daniel Stern
4 Die Bedeutung der frühkindlichen Beziehungserfahrungen in der Selbst-Theorie Biermann-Ratjens
5 Die Entwicklung des Selbst bei Martin Dornes und Vertretern der Mentalisierungstheorie
6 Das personenzentrierte Konzept der Entwicklung der Persönlichkeit von Carl R. Rogers
7 Unterschiede / Gemeinsamkeiten der Konzepte
8 Resumé – persönliche Stellungnahme
9 Literaturverzeichnis