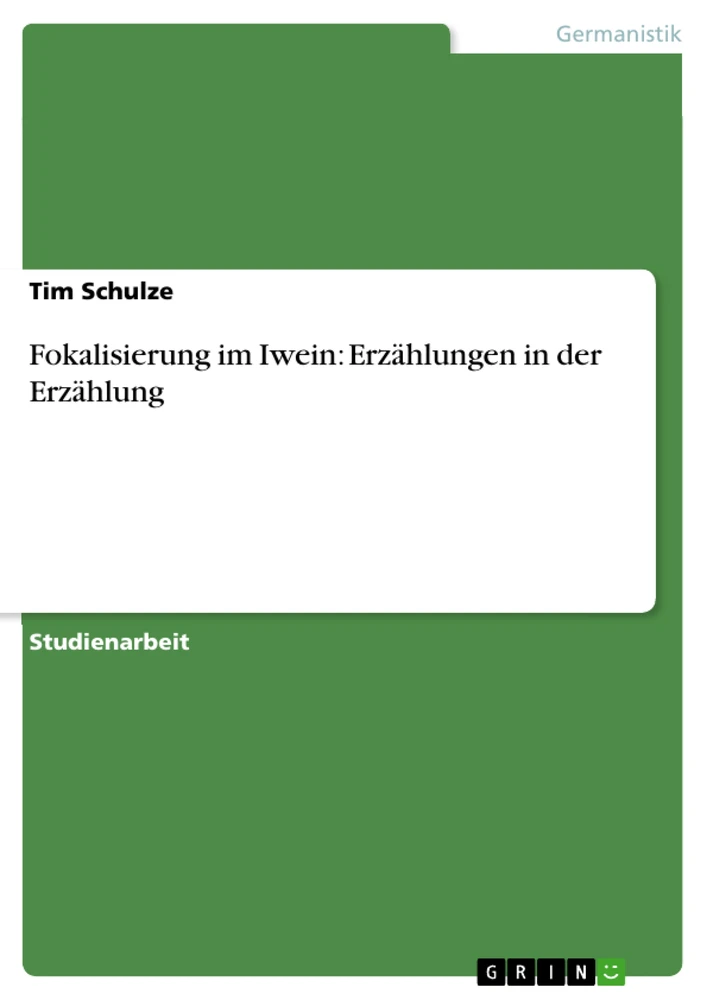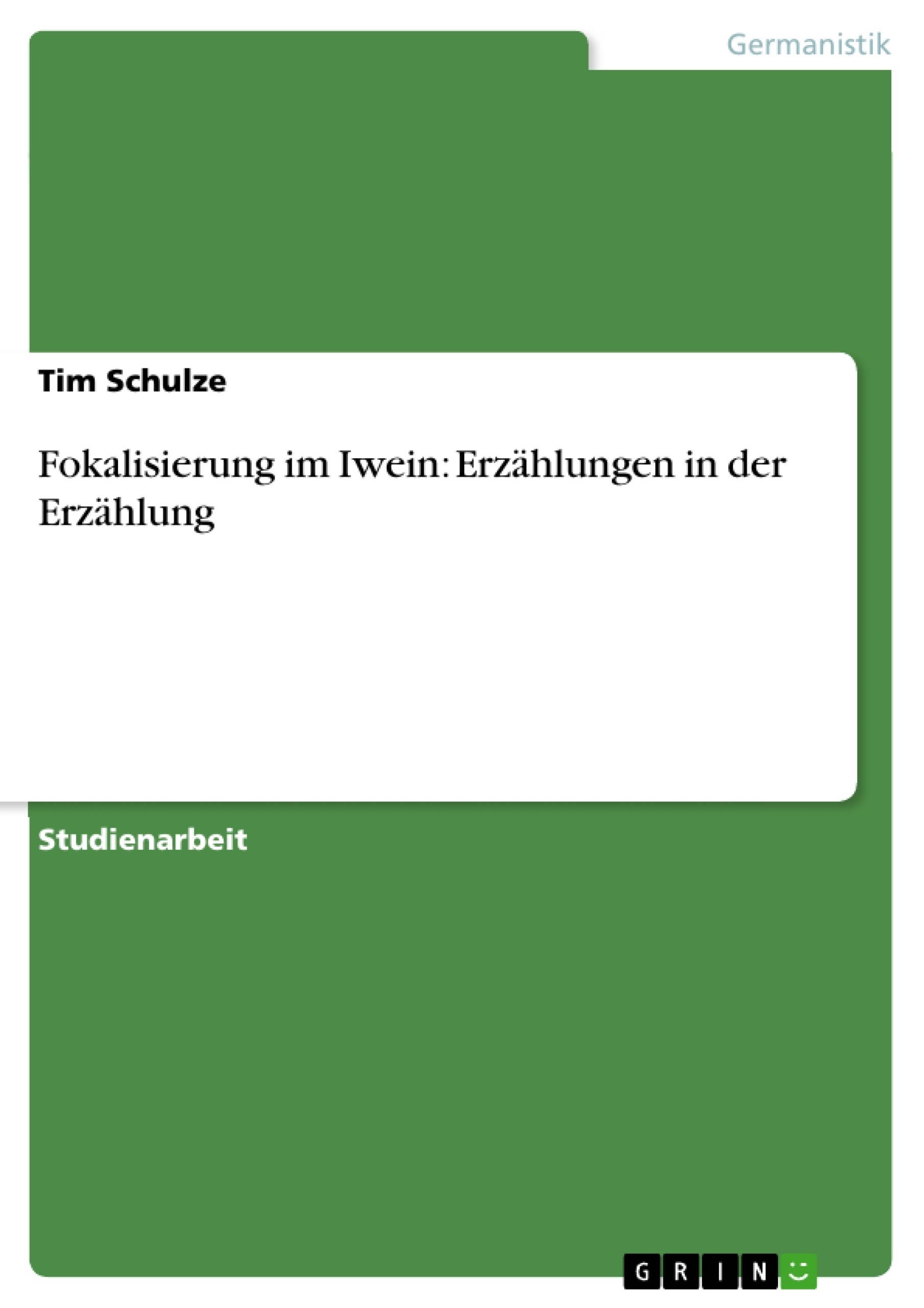1. Einleitung
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit Formen der Fokalisierung im Iwein Hartmanns von Aue. Fokalisierung ist ein Begriff aus der Erzähltheorie und wurde durch den Literaturwissenschaftler Gérard Genette geprägt. Daher soll im Kapitel 2 Darstellung des Fokalisierungsbegriffs zunächst eine Grundlage in Form der Diskussion von Genettes Fokalisierungsbegriff für die folgende Untersuchung gelegt werden. Hierbei wird sich am entsprechenden Teil der von Matias Martinez und Michael Scheffel verfassten Einführung in die Er¬zähltheorie orientiert. Nach der Darstellung von Genettes Konzept in Kapitel 2.1 Der Fokalisierungsbegriff nach Gérard Genette wird in Kapitel 2.2 Kritische Auseinandersetzung mit dem Fokalisierungsbegriff von Gérard Ge¬nette anhand der Überlegungen Gert Hübners dargelegt, worin die Problematik besteht, wenn Genettes Fokalisierungsbegriff auf den höfischen Roman angewendet werden soll.
In Kapitel 3.1 Fokalisierungstechniken im höfischen Roman werden zunächst die in Gert Hübners Aufsatz Fokalisierung im höfischen Roman als charakteristisch für den höfischen Roman herausgestellten Formen der Fo¬kalisierung dargelegt. Daran schließt sich mit Kapitel 3.2 Fokalisierung im Iwein - Exemplarische Untersuchung anhand der Erzählungen von der Brun-nen-aventiure und der Erzählung von Ginovers Entführung eine Untersuchung verschiedener Textpassagen an. Es soll dabei herausgearbeitet wer-den, ob bzw. inwiefern fokalisiert erzählt wird und welche Funktionen und Ursachen die unterschiedlichen Erzählweisen besitzen.
Des Weiteren sollen im Verlauf der Arbeit erzähltheoretische Begriffe wie bspw. das personale Erzählen von Fokalisierungstechniken abgegrenzt werden.
2. Darstellung des Fokalisierungsbegriffs
2.1 Der Fokalisierungsbegriff nach Gérard Genette
Der Begriff der Fokalisierung wurde 1972 von Gérard Genette in der franzö-sischen Erstauflage eingeführt und bezieht sich auf die Perspektivierung des Erzählten. Er beschreibt das Verhältnis zwischen dem Wissen einer Erzählin¬stanz und dem Wahrnehmungshorizont einer Figur. Daher unter-scheidet man nach Genette zwei Standpunkte: Den Standpunkt des Spre-chers und den Standpunkt des Wahrnehmenden, woraus sich die beiden Fragen „Wer sieht bzw. nimmt wahr?“ und „Wer spricht?“ ergeben. Während sich die Frage nach dem Sprecher dem Erzählakt zuordnen lässt, ist der Standpunkt des Wahrnehmenden jener, an dem sich fokalisiertes Erzählen nachweisen lässt [...]
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Darstellung des Fokalisierungsbegriffs
2.1 Der Fokalisierungsbegriff nach Gérard Genette
2.2 Kritische Auseinandersetzung mit dem Fokalisierungsbegriff von Gérard Genette
3. Fokalisierung im Iwein: Erzählungen in der Erzählung
3.1 Fokalisierungstechniken im höfischen Roman
3.2 Fokalisierung im Iwein - Exemplarische Untersuchung anhand der Erzählungen von der Brunnen-aventiure und der Erzählung von Ginovers Entführung
4. Schlusswort
5. Literaturverzeichnis