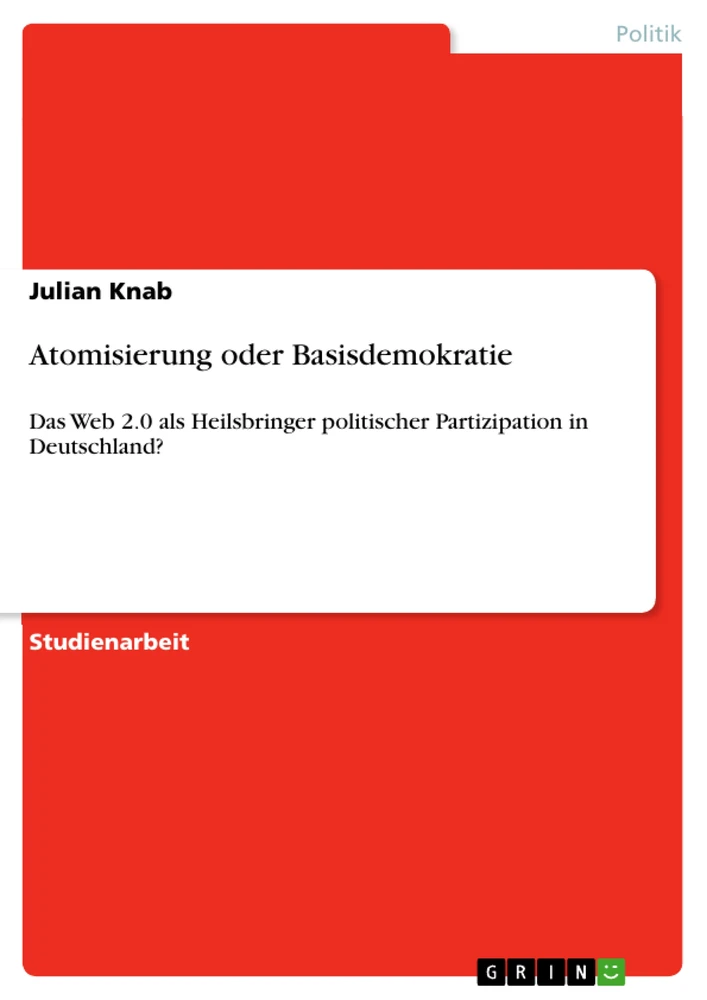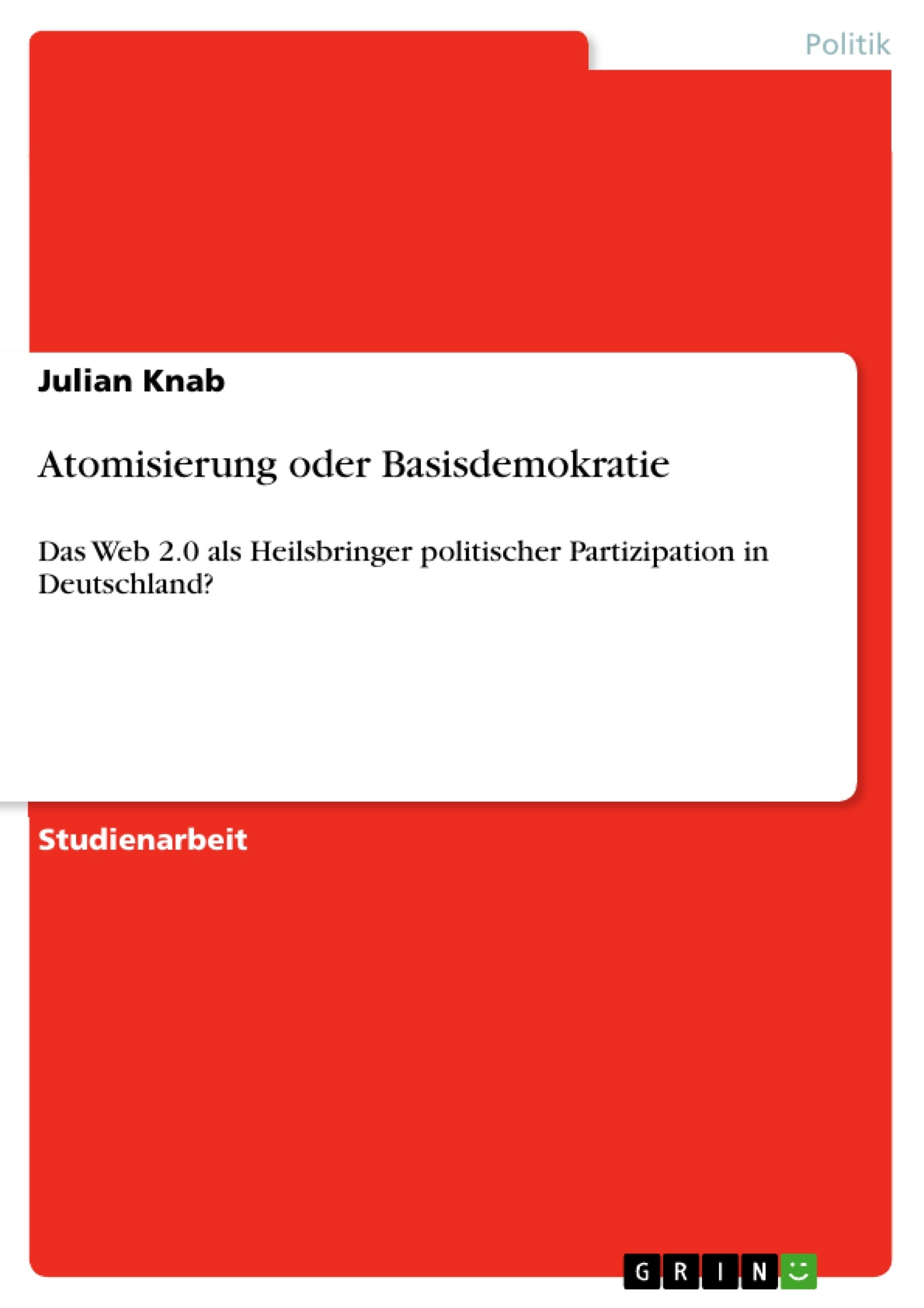In Zeiten politischer Grabenkämpfe um die „Mitte“ der Gesellschaft, deren Gunst die beiden großen Volksparteien durch politische Annäherung an die Wählerschichten der jeweils anderen zu erreichen versuchen lässt sich eine zunehmende Loslösung von ideologischen Fundamenten sowie die Tendenz zur Besetzung politischer Themen aus rein wahltaktischen Beweggründen beobachten. Ein solches System der rationalen, Stimmen-maximierenden Parteien zeigt dabei Parallelen zur Demokratietheorie Anthony Downs’. Dabei weist im Speziellen dessen „paradox of voting“ unter Annahme einer ebensolchen Kosten/Nutzen-Abwägung seitens der Bürger auf eine zu erwartende Wahlbeteiligung von null Prozent hin. Praktisch ist selbige in der Bundesrepublik seit den 70er Jahren rückläufig und erreichte bei der Wahl zum 16. Deutschen Bundestag im Jahr 2005 mit 77,7% ihren historischen Tiefststand. Zur Beseitigung des sich hieraus ergebenden, für einen Verfassungsstaat dessen Selbstverständnis nach nicht tragbaren Legitimationsdefizits ist man sich dabei über Parteigrenzen hinweg einig und postuliert die Förderung politischer Partizipation breiter Gesellschaftsschichten. Zu beachten ist dabei, dass ebendieses Konzept weit über die Ausübung des aktiven Stimmrechts hinausgeht und sich dabei in beispielsweise „autonomen“ Kreisen sogar im bewussten Fernbleiben vom Wahllokal äußern kann. Vielmehr stehen dabei engere Einbindung der Bürger in den politischen Prozess sowie die Stärkung von Bürgerinitiativen im Fokus.
Die vorliegende Arbeit soll dabei die Rolle des Internets, insbesondere des Phänomens „Web 2.0“, als möglichen Katalysator politischer Partizipation in Deutschland examinieren. Hierzu sollen zunächst anhand verschiedener Theorien die Möglichkeiten digitaler Partizipation, gleichzeitig aber auch die Gefahr eines gesamtgesellschaftlichen Bruchs zwischen „On- und Offlinern“ (Digital Divide) aufgezeigt werden. In einem dann zweiten Schritt solle der digitale status quo der Bundesrepublik anhand empirischer Studien überprüft werden, um im Folgenden zu einer wirklichkeitsgetreuen Beurteilung des Partizipation-fördernden Charakters des Mediums Internet zu gelangen.
Gliederung
1. Einleitung
2. Theoretischer Zugang
2.1. Politische Partizipation
2.2. DasWeb2.0
2.3. E-Democracy, E-Government & Digitale Demokratie
2.4. Net-Empowerment & Reinforcementthese
2.5. Theorie des Digital Divide
3. Empirische Untersuchung
3.1 Die ARD/ZDF-Onlinestudie 2008
3.1.1. Methodik
3.1.2. Studienergebnisse
3.2. Emmer, Seifert&Vowe 2006
4. Fazit
5. Bibliographie