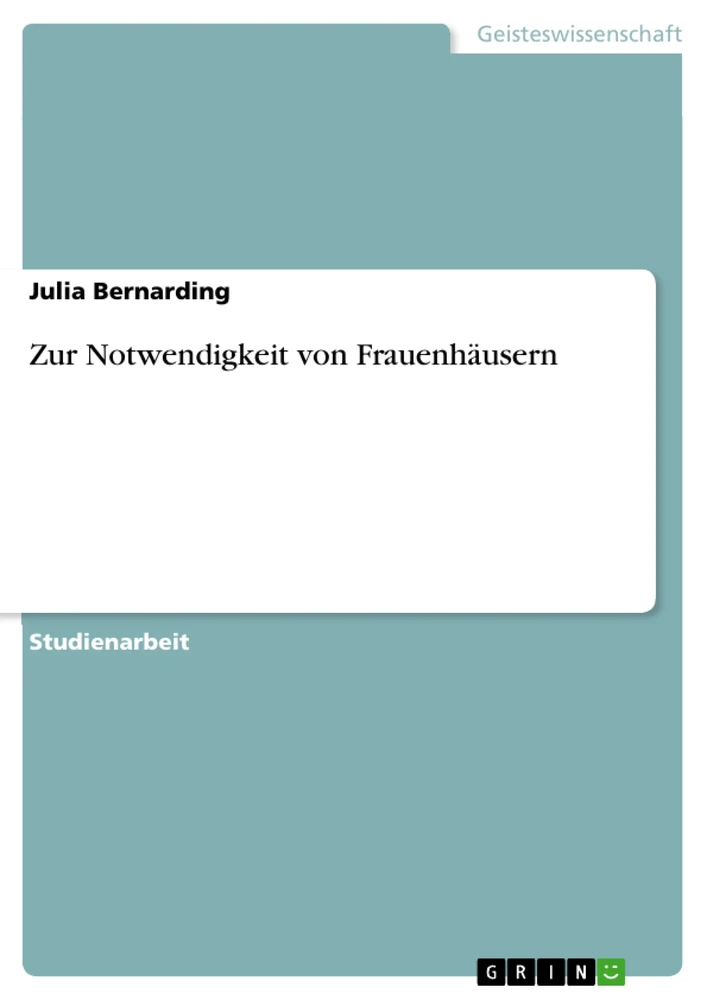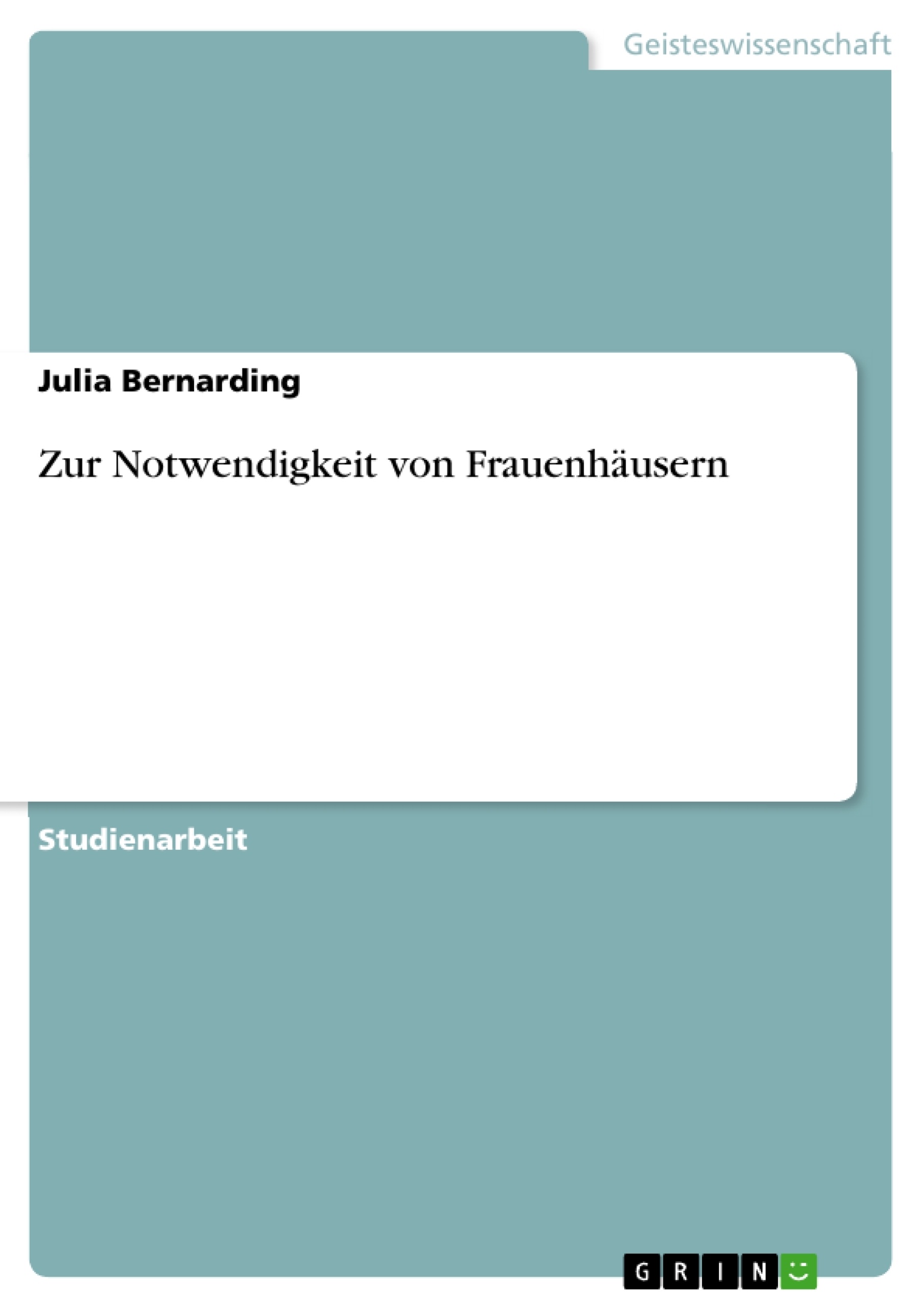Ziel dieser Arbeit ist, Gründe aufzuzeigen, warum Frauenhäuser auch heute so wie in Zukunft einen wichtigen und unverzichtbaren Bereich im sozialen Sektor darstellen.
Dazu wird die Arbeit in zwei Teile gegliedert. Teil I befasst sich mit zentralen Begriffen und Definitionen sowie dem geschichtlichem Hintergrund der Frauenbewegungen und der damit im Zusammenhang stehenden Entstehung von Frauenhäusern.
Der zweite Teil bezieht sich auf die zentralen Aufgaben, die Frauenhäusern heute zu Grunde liegen sowie auf theoretische und empirische Erkenntnisse im Bereich der häuslichen Gewalt. Daraus ergeben sich Gründe für die Existenzberechtigung und Notwendigkeit von Frauenhäusern.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Teil I
2.1 Klärung zentraler Begriffe
2.1.1 Häusliche Gewalt
2.1.2 Frauenbewegung
2.1.3 Frauenhäuser
2.2 Ein Exkurs durch die Geschichte der Frauenbewegung
2.3 Die Entstehung von Frauenhäusern: „Das private ist politisch!“
3 Teil II
3.1 Aufgaben und Angebote der Frauenhäuser
3.1.1 Krisenintervention
3.1.2 Beratung
3.1.3 Öffentlichkeitsarbeit
3.1.4 Prävention
3.2 Die Notwendigkeit von Frauenhäusern anhand empirischer Daten
3.3 Ein Exkurs zu männlichen Gewaltwiderfahrnissen
4 Diskussion und Fazit
Literaturverzeichnis