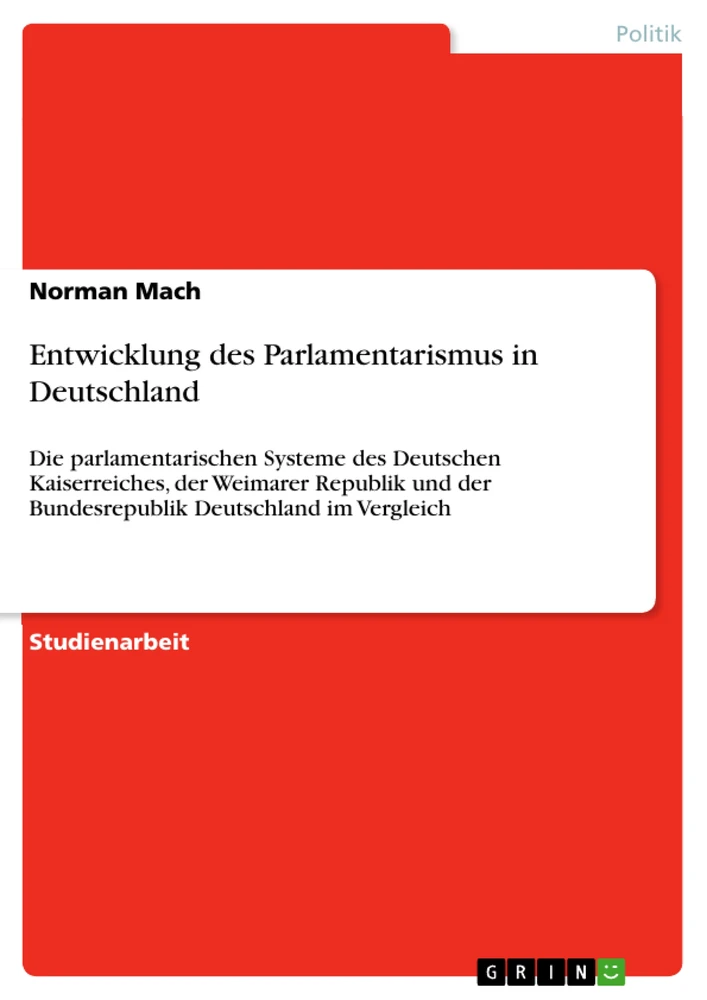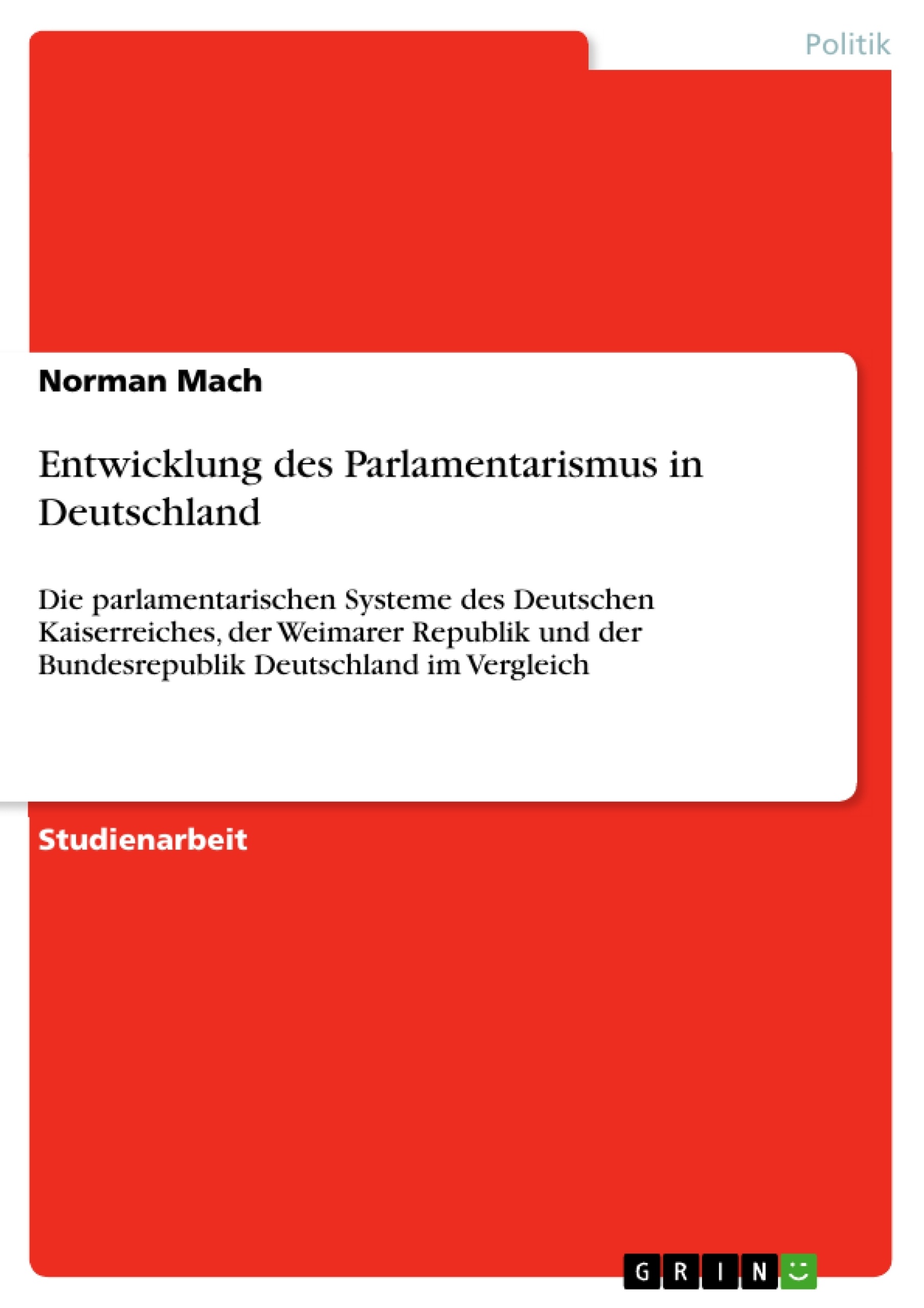In der folgenden Hausarbeit soll ein historischer Abriss der Entwicklung des deutschen Parlamentarismus von der Gründung des ersten deutschen Bundesstaat 1867 in Form des Norddeutschen Bundes bis hin zur Gründung der Weimarer Republik im Jahr 1919 dargestellt werden. Der Schwerpunkt wird in den Wechseljahren 1918/1919 liegen. Anschließend soll deskriptiv dargestellt werden, welchen Einfluss die beiden vorherigen parlamentarischen Systeme auf das aktuelle parlamentarische Regierungssystem der Bundesrepublik Deutschland haben um aufzuzeigen, inwieweit die stetigen Vergleiche in der Presse und der Politik an sich mit den früheren parlamentarischen Systemen sinnhaft sind.
Inhalt
1. Einleitung
2. Definitionen
3. Die Entwicklung des Parlamentarismus in Deutschland nach 1867
4. Parlamentarische System des Kaiserreiches
5. Parlamentarische System der Weimar Republik
6. Das parlamentarische System der Bundesrepublik Deutschland
6.1. im Vergleich zum Kaiserreich
6.2. zur Weimarer Republik
7. Zusammenfassung
8. Literaturverzeichnis