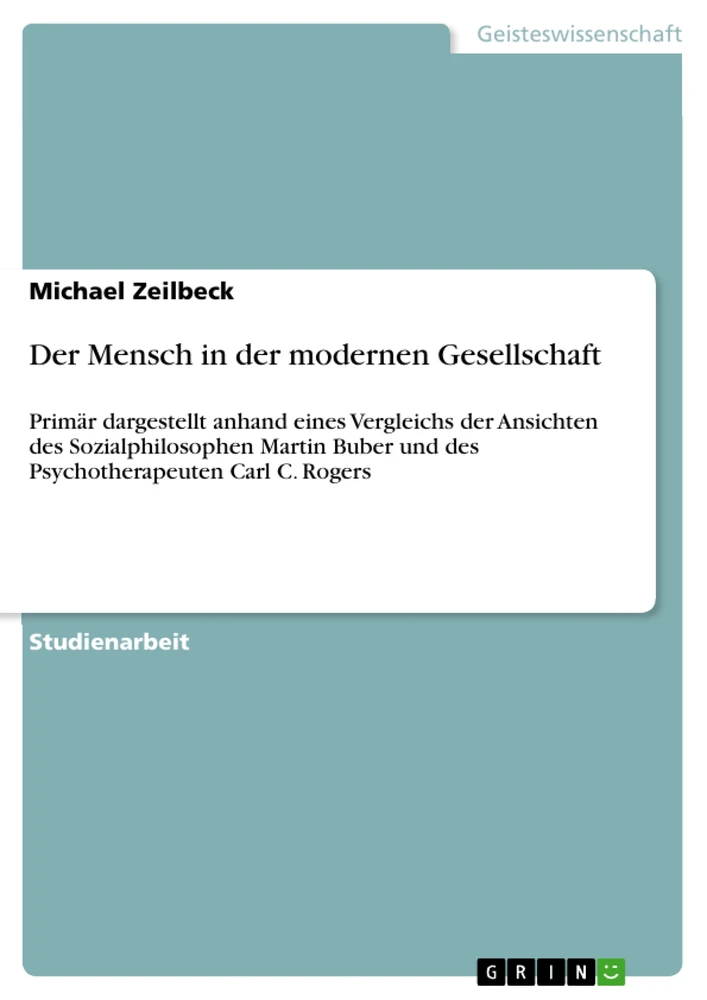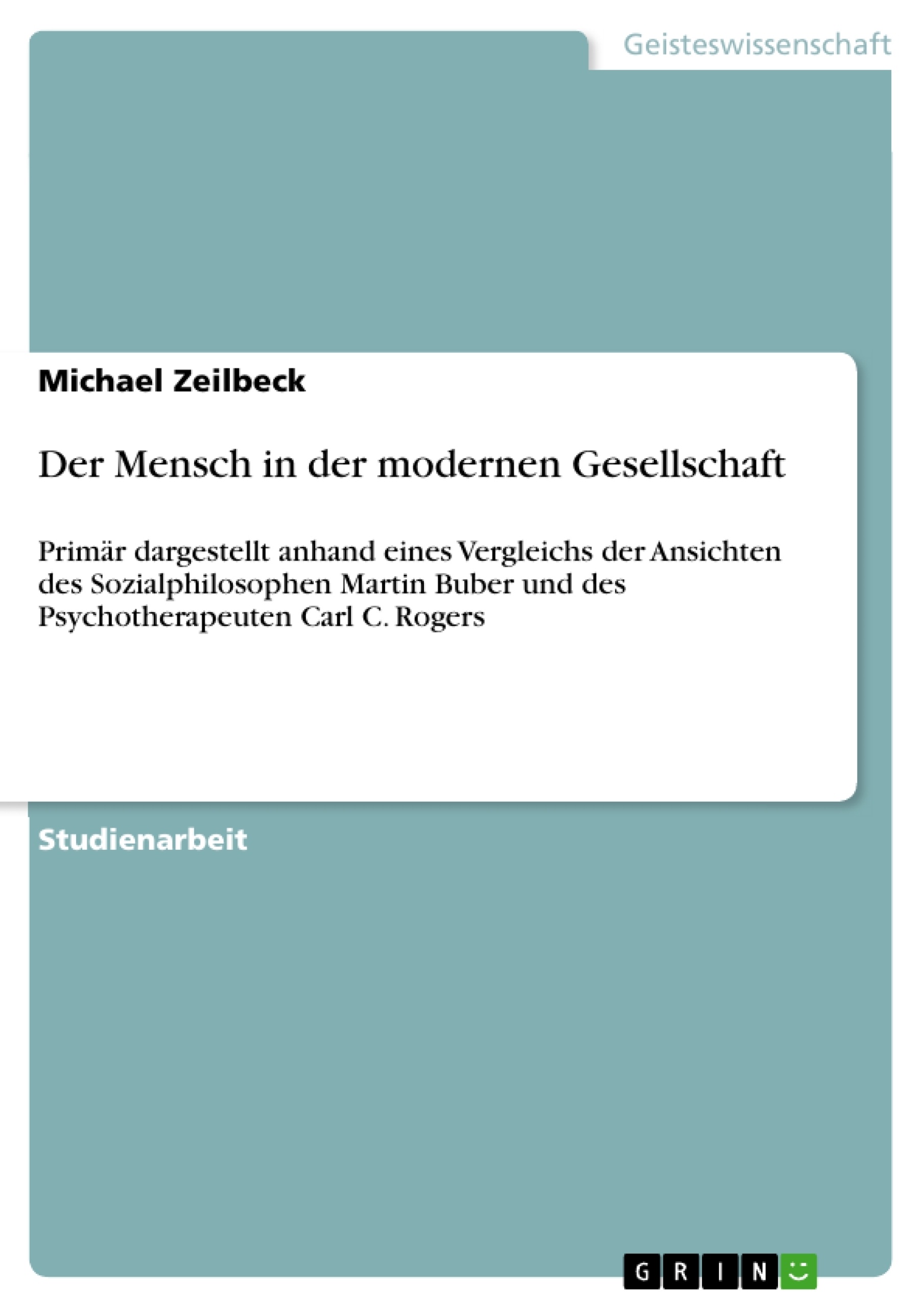Die folgende Arbeit befasst sich im Rahmen unseres Seminars „Den Anderen als Anderen sehen“ mit der Thematik des Menschseins in unserer heutigen Gesellschaft. Gerade jetzt, da die Zeit, die im bayerischen Sprachgebrauch auch „Stade Zeit“ genannt wird erst kürzlich im Zentrum unseres Lebens stand und uns immer wieder einmal jährlich zu Solidarität und Besinnlichkeit aufruft, scheint es mir wichtig und interessant zu sein, sich näher mit unserem Dasein zu beschäftigen. Mit Martin Buber kommt der religiöse Aspekt zu tragen, der in der Praxis spätestens durch die Weihnachtskrippe unter dem Christbaum oder den traditionellen Kirchen-besuch wieder Berücksichtigung gefunden hatte. Zudem scheint mir das Fortschreiten der gesellschaftlichen Klassifizierung, die mit dem ins Land gerufenen Begriff „Prekariat“ eine neue Dimension erreicht, ohne das Einbeziehen existentiell wichtiger Fragen zu geschehen. Ziel dieser Arbeit ist es, die als hektisch, unbesinnlich und oberflächlich geltende Gesellschaft kritisch zu beleuchten und aus der Sicht Martin Bubers und Carl C. Rogers zu untersuchen.
Wenn dabei von Vergleich die Rede ist, sind damit zwangsläufig, da ich beide vorweg als Humanisten innerhalb ihrer Profession bezeichnen möchte, immer auch Parallelen des methodischen bzw. praktischen Ansatzes Rogers und der postulierten „Ich-Du-Beziehung“ Bubers impliziert bzw. erkennbar, die jedoch hier nur peripher angesprochen werden sollen. Diese Feststellung gründet wie Suter anführt, auf folgender Tatsache: "... ′Wichtige Anregungen erfuhr Rogers durch Kirkegaard und durch Martin Buber (...)′" (Suter, 1986, S.2), was Buber betreffend daran deutlich wird, dass Rogers "in seinen Werken, die nach dem Treffen mit Buber erschienen, [...] zur Kennzeichnung der von ihm geforderten zwischenmenschlichen Beziehung immer wieder den Ausdruck 'Ich-Du-Beziehung im Sinne Martin Bubers' [benützt]" (Suter, 1986, S.2). Aufgrund dieser Feststellung scheint es mir interessant zu sein, trivial formuliert, die Ansichten beider bezüglich des (Zusammen-)Lebens der Menschheit im (post-)modernen Zeitalter zu vergleichen. Den Einstieg wird eine Darstellung der Professionsidentität Bubers und Rogers bilden, Suter nennt dies ihr „Selbstverständnis“, da dies aus meiner Sicht wichtig ist, um ähnliche, aber auch unterschiedliche Ansichten und Meinungen besser nachvollziehen zu können.
Gliederung
1 Einleitung
2 Professionsidentität
2.1 Martin Buber
2.2 Carl C. Rogers
3 Der (post)moderne Mensch
3.1 Martin Buber
3.2 Carl C. Rogers
4 Vergleich / Fazit
4.1 Professionsidentität
4.2 Der (post)moderne Mensch
5 Weitere Ansichten
5.1 Jürgen Habermas
5.2 Otto Speck
6 Persönliche Stellungnahme
Literaturverzeichnis