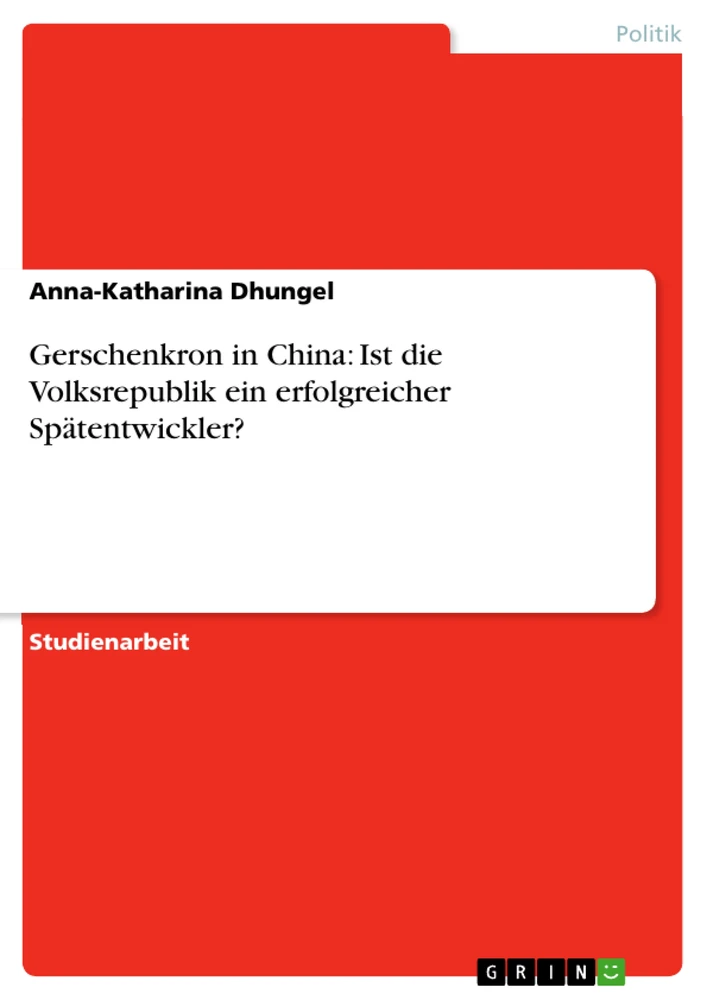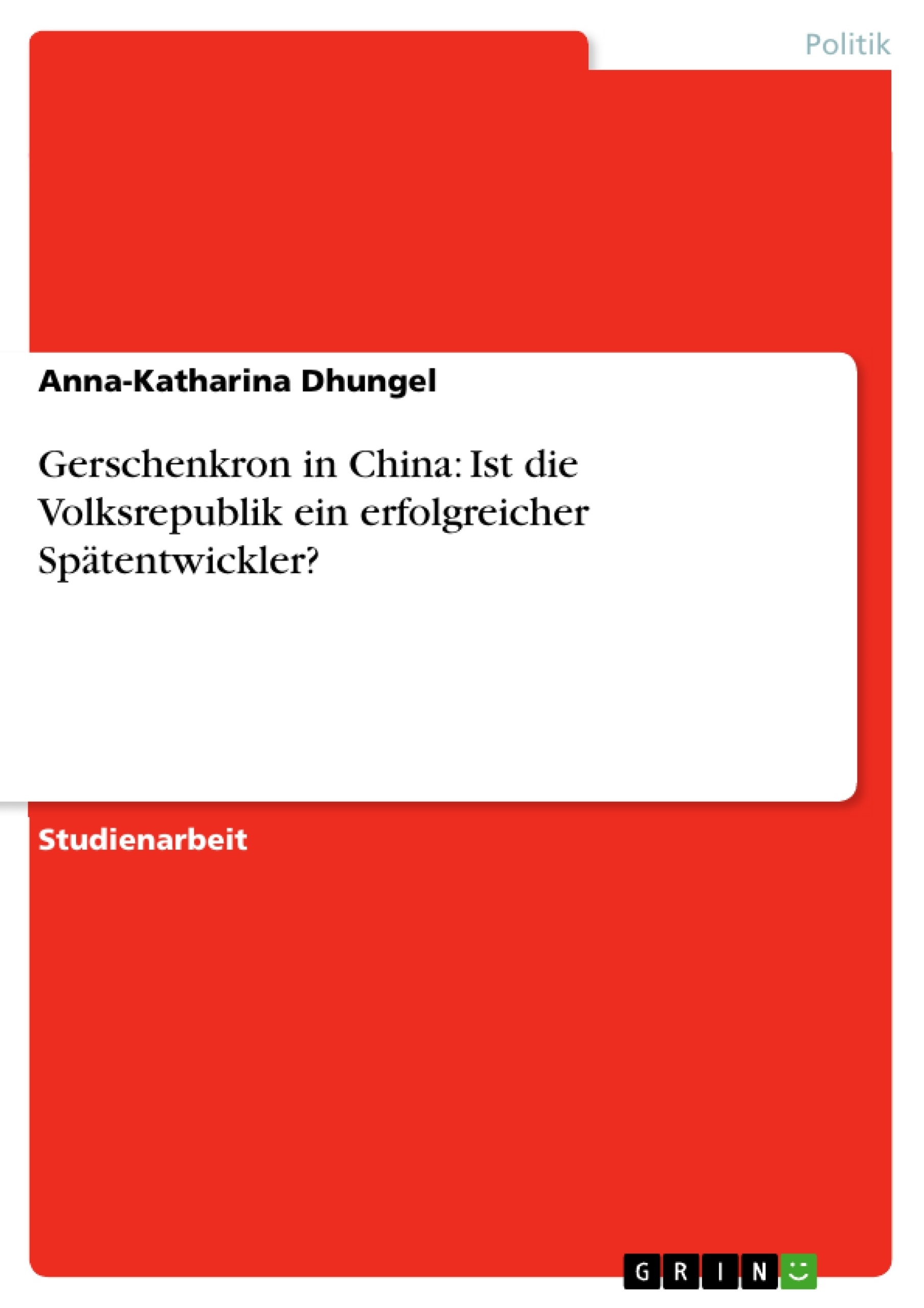Diese Hausarbeit untersucht, inwiefern China im „gerschenkronischen“ Sinne
als erfolgreicher Spätentwickler gilt und ob sich im Reich der Mitte ebenfalls
Institutionen eigener Art entwickelt haben. Im Mittelpunkt steht dabei das
chinesische Bankensystem. Zunächst wird jedoch das Essay von Gerschenkron
genauer erläutert um seine Behauptungen zu verdeutlichen. Da für ihn das Deutsche
Reich ein Paradebeispiel gelungener Spätentwicklung ist, wird anschließend die
deutsche Entwicklung vorgestellt. Darauf aufbauend wird dann in den fernen Osten
geschaut und vergleichend analysiert, wie die chinesische Entwicklung nach
Gerschenkron eingeordnet werden könnte.
Inhalt:
1. Einleitung
2. „Economic Backwardness in Historical Perspective“- Eine Zusammenfassung
3. Die Deutsche Industrialisierung
3.1 Der internationale Kontext.
3.2 Die politische Entwicklung
3.3 Die wirtschaftliche Entwicklung
3.4 Das Bankensystem
4. Die Volksrepublik China.
4.1 Der internationale Kontext
4.2 Die politische/wirtschaftliche Entwicklung
4.3 Das Bankensystem
5. Zusammenfassung
6. Literatur
7. Anhang