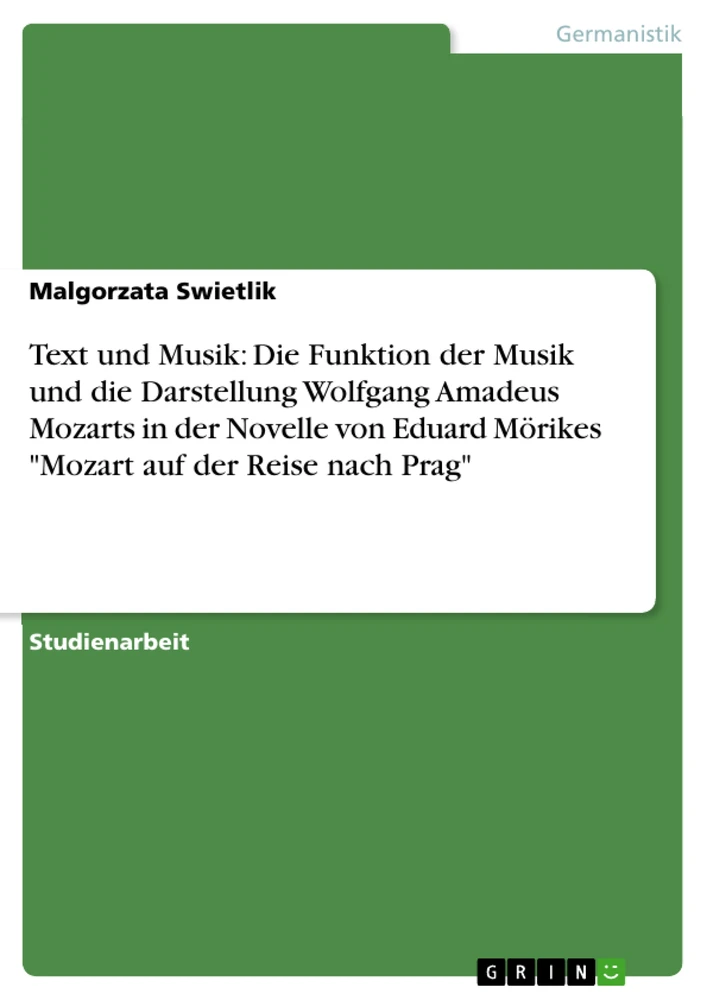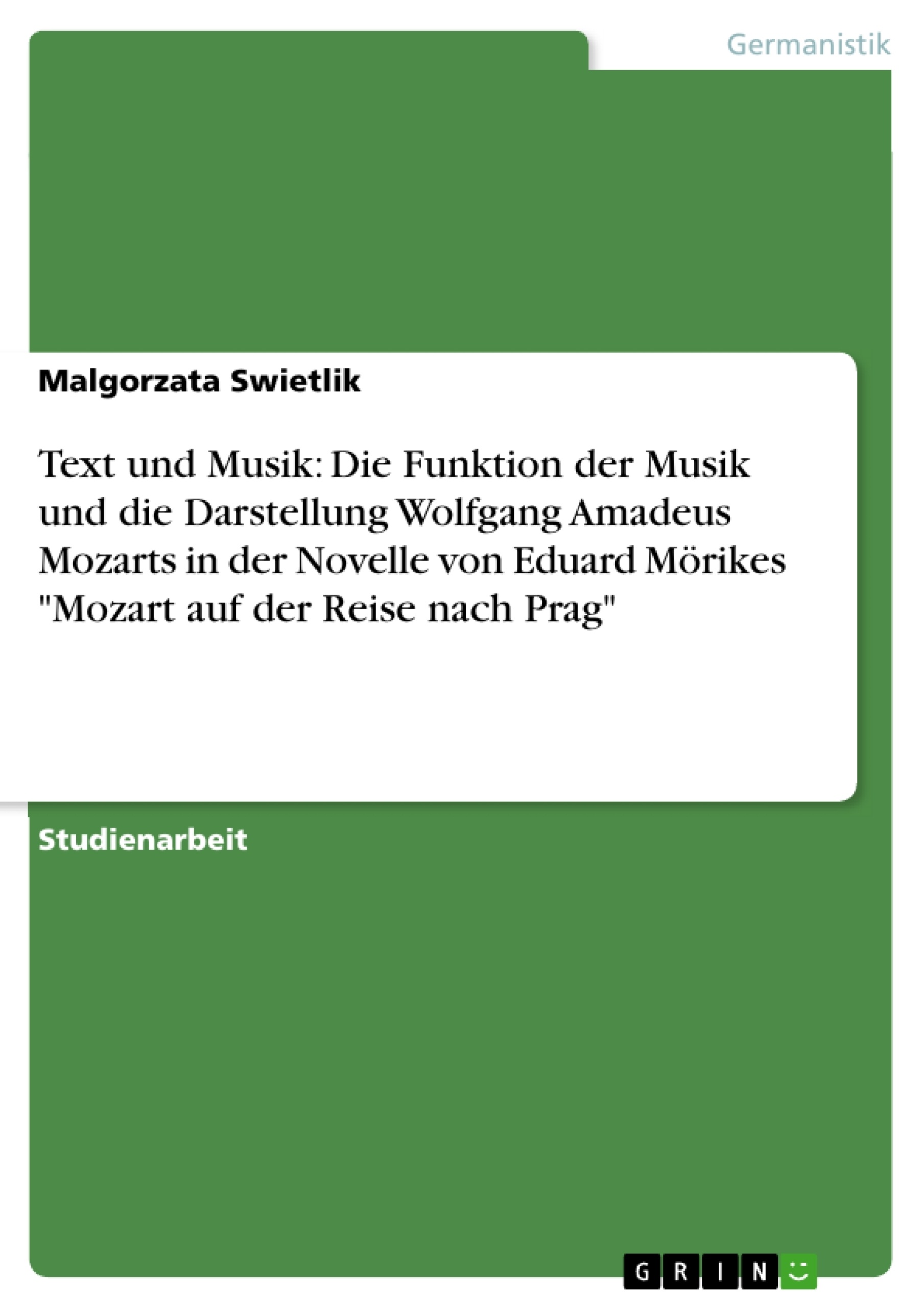[...] Diese Ausarbeitung beschäftigt sich mit der Wechselwirkung zwischen Text und Musik, die außerhalb der drei erläuterten Forschungsbereiche steht. Die Einwirkung von Musik auf ein Prosawerk manifestiert sich in der Novelle von Eduard Mörike „Mozart auf der Reise nach Prag“ in der dichterischen Behandlung von Mozarts Musik. Eduard Mörike ist gelungen,Musik in einem literarischen Text zu gestalteten. „Musik, Sprechen über Musik, Ringen um Musik, Vorführen von Musik, Wirkung der Musik durchziehen als Leitschiene diese Musikernovelle.“
In dieser Ausarbeitung wird der Versuch unternommen, die Funktion von Musik und die Rolle, welche sie in der Novelle spielt, zu erforschen. Zudem versuche ich die Darstellung von Wolfgang Amadeus Mozart hinsichtlich unterschiedlicher Elemente zu diskutieren. [...]
Inhaltsverzeichnis
1. Text und Musik
2. Eduard Mörike „Mozart auf der Reise nach Prag“
3. Die Darstellung des Komponisten: Sensibilität für Natur,
Bescheidenheit, Geselligkeit, Verschwendung und Melancholie
3.1 Sensibilität für Natur
3.2 Bescheidenheit
3.3 Geselligkeit
3.4 Verschwendung
3.5 Melancholie
4. Die Darstellung Konstanze Mozarts
5. „Don Giovanni“ – Inspiration und Komposition des Hochzeitsliedes und der Todesszene
Das Hochzeitslied
Die Kirchhofszene
6. Die Bedeutung der Kirchhofszene aus „Don Giovanni“ für die Darstellung des Komponisten
7. Schlussfolgerungen
Literaturverzeichnis