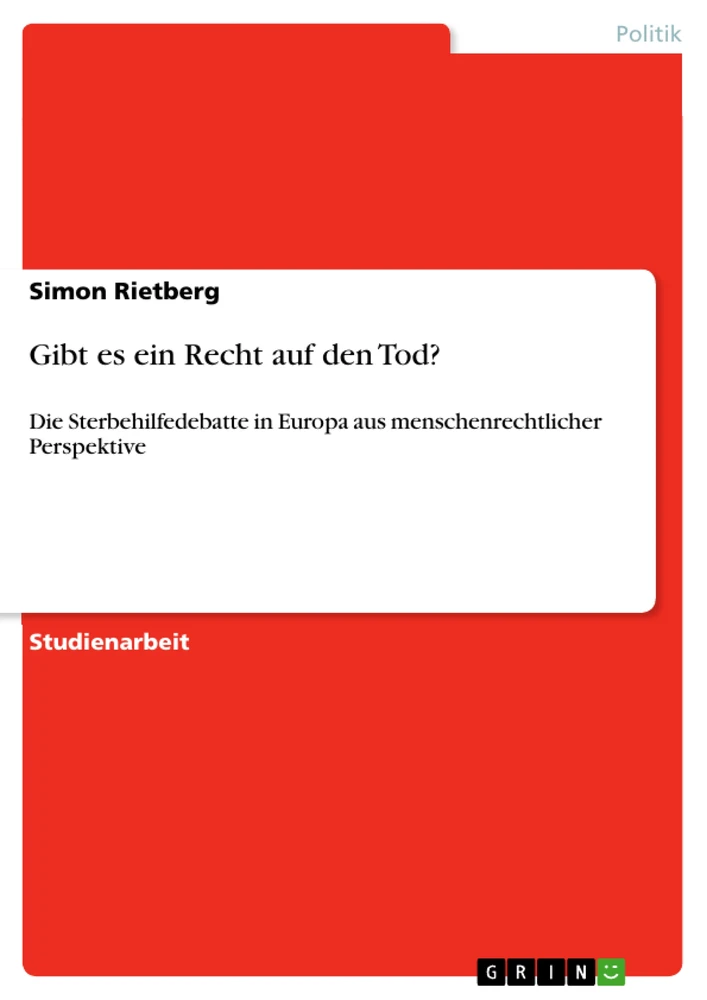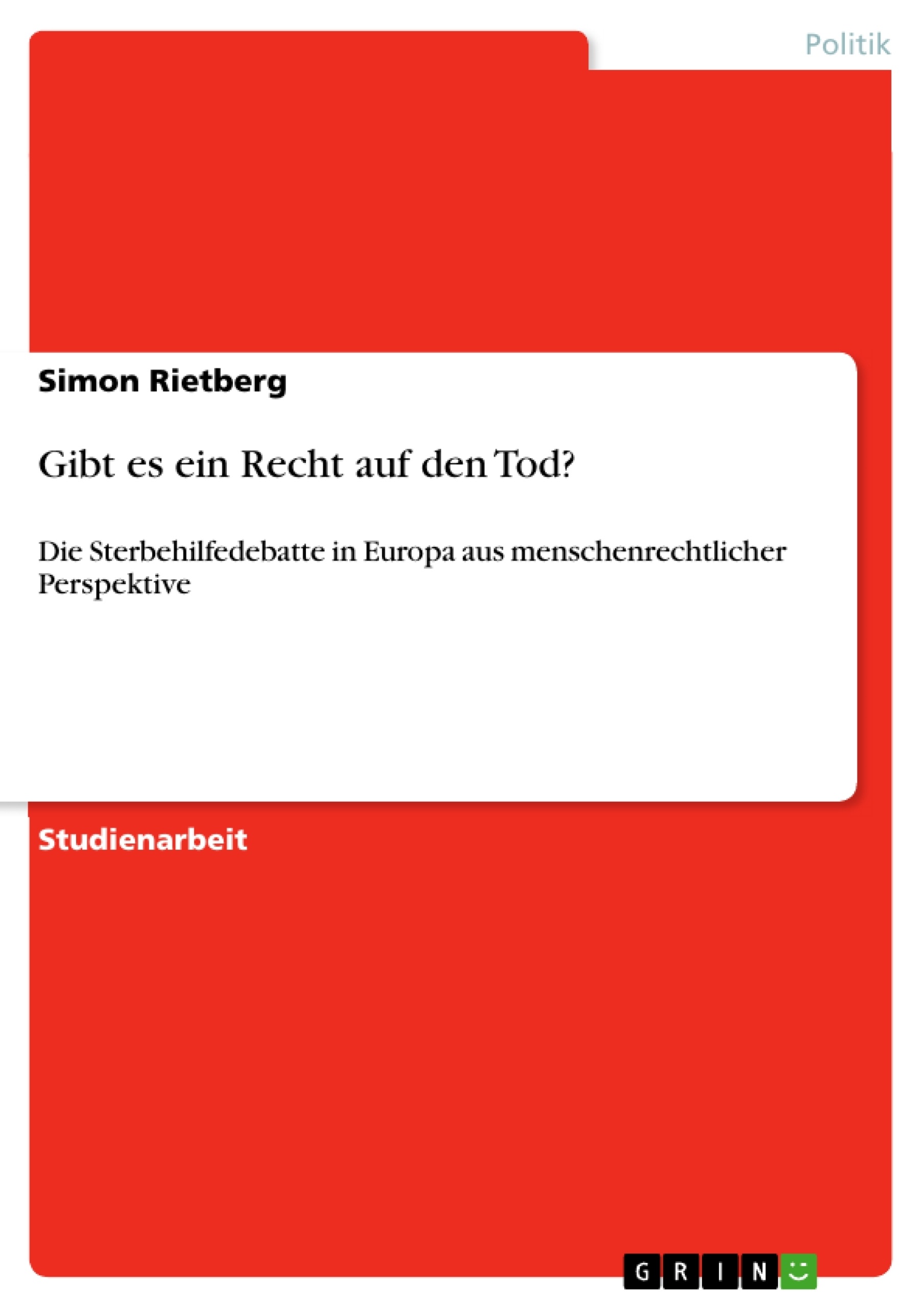Sterbehilfe gehört in Europa mit Sicherheit zu einem der am kontroversesten debattierten Themen. Über wenige andere Aspekte wird derart heftig gestritten. Vor allem die Frage, ob Menschen ein Anrecht auf einen würdigen Tod haben, steht dabei im Mittelpunkt der Diskussion. Während beispielsweise in den Niederlanden bereits gesetzliche Regelungen geschaffen wurden, die ein Sterben in Würde ermöglichen, ist Sterbehilfe in vielen anderen europäischen Ländern (noch) nicht eindeutig geregelt.
Die vorliegende Arbeit nimmt die Frage, ob Menschen über ein Recht auf Sterben verfügen, genauer unter die Lupe. Bei deren Analyse steht jedoch weniger die innerstaatliche Ebene im Mittelpunkt. Vielmehr wird die Frage aus Sicht der Menschenrechte, insbesondere der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK), genauer betrachtet. Der Autor dieser Arbeit vertritt dabei die Ansicht, dass aus menschenrechtlicher Perspektive aufgrund der sterbehilfespezifischen Widersprüchlichkeit der EMRK keine eindeutige Antwort auf die Frage, ob ein Anrecht auf Sterbehilfe besteht oder nicht, gegeben werden kann. Diese These soll in dieser Seminararbeit genauer untersucht werden. Beginnend mit einer kurzen Definition von Sterbehilfe, die den Leser über die verschiedenen Unterformen aufklären soll, und einem Überblick über die rechtliche Lage in Europa, wendet sich die Arbeit dann den menschenrechtlichen Aspekten zu. Dabei wird zuerst eine Übersicht über die für die Sterbehilfe relevanten Menschenrechtsartikel gegeben. Anschließend werden Fälle von Sterbehilfe dargestellt, die bereits vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte verhandelt wurden. Zum Schluss werden in einer Zusammenfassung die Ergebnisse dieser Arbeit resümiert. Dabei soll abschließend auch die oben aufgeführte These überprüft werden.
INHALTSVERZEICHNIS
0. Einleitung
1.Sterbehilfe – was ist das eigentlich?
1.1. Direkte/aktive Sterbehilfe
1.2. Indirekte Sterbehilfe
1.3. Passive Sterbehilfe
1.4. Suizidbeihilfe
2. Rechtliche Situation in ausgewählten europäischen Staaten
2.1. Die Niederlande
2.2. Deutschland
2.3. Italien
2.4. Weitere europäische Länder im Überblick
2.5. Fazit
3. Menschenrechtliche Aspekte
3.1. Menschenrechtlicher Rahmen
3.1.1. Pro Sterbehilfe
3.1.2. Contra Sterbehilfe
3.1.3. Fazit
3.2. Konkrete Fälle
3.2.1. Der Fall Diane Pretty
3.2.2. Der Fall Ernst Haas
3.2.3. Der Fall Ilse Koch
3.2.4. Fazit
4. Zusammenfassung
5. Literaturverzeichnis
5.1. Broschürenreihen
5.2. Internetquellen
5.2.1. Gerichtsbeschlüsse
5.2.2. Gesetzesfassungen
5.2.3. Menschenrechtsverträge
5.2.4. Nachrichten-, Zeitungs- und Zeitschriftenportale
5.2.5. Sonstige Internetquellen
5.3. Magazine
5.4. Monographien
5.5. Sammelbände