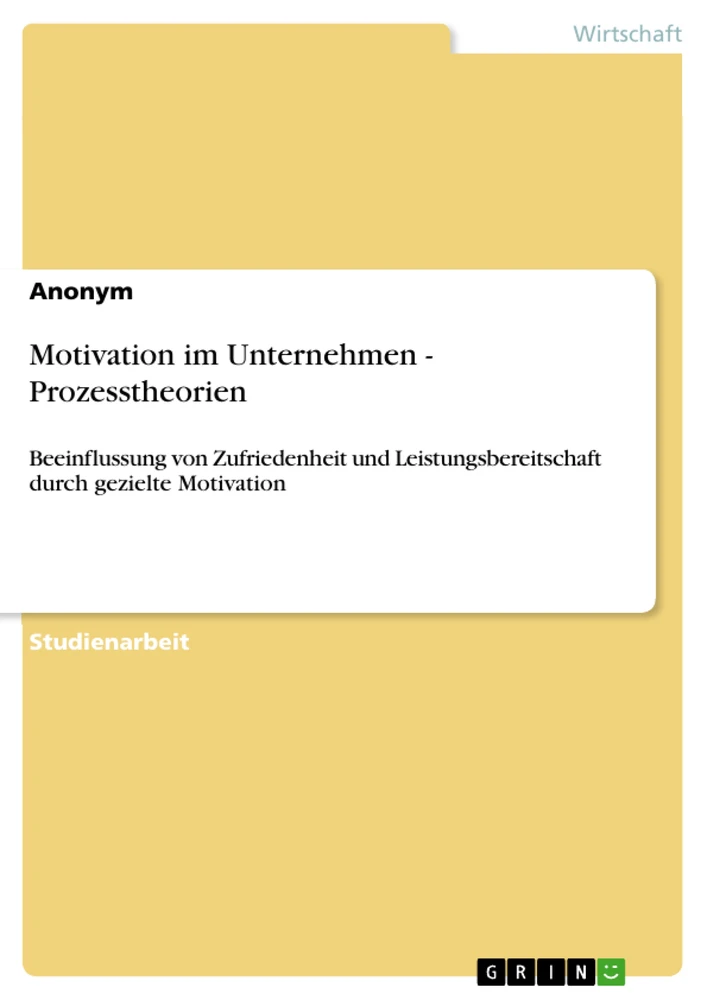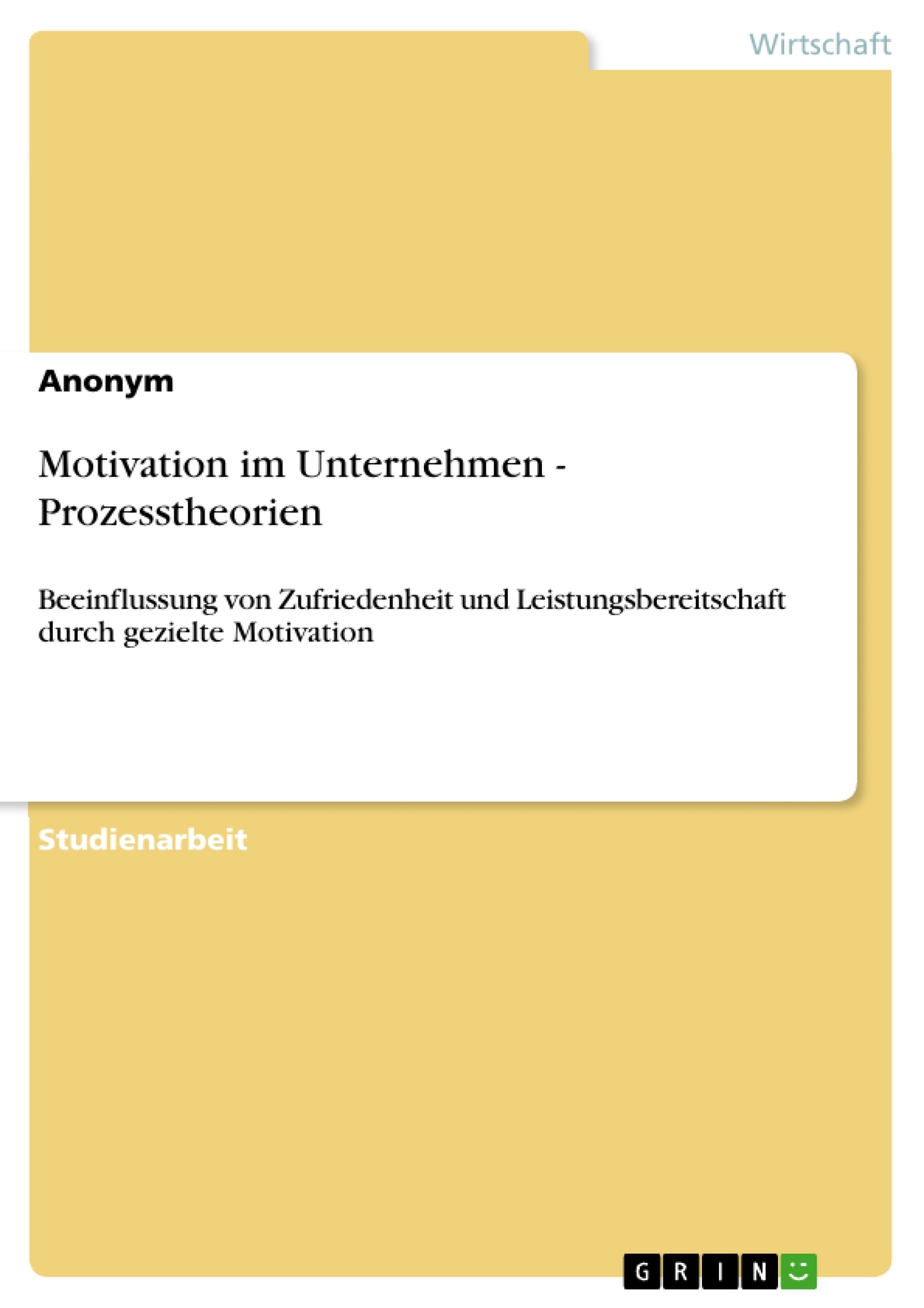1.1 Einführung in die Problemstellung
Was jedoch ist Motivation genau und wie funktioniert sie?
Schon im antiken Griechenland wurden erste Schritte unternommen das menschliche Verhalten und seine Beweggründe zu erklären. Hierbei entstand die These, dass es der Natur des Menschen entspricht Unangenehmes wie Schmerz und Unlust zu vermeiden und Angenehmes wie Vergnügen und Lust anzustreben.
Im Laufe der Jahrhunderte entstanden vielerlei Ansätze und Forschungsrichtungen die Gründe und Ursachen des menschlichen Verhaltens zu erklären. Siegmund Freud prägte die These der Trieb- und Instinkthandlungen, Burrhus Skinner die Anfänge der kognitiven Lerntheorie und Barbuto und Scholl definierten die Quellen der intrinsischen und extrinsischen Motivation.
1.2 Zielsetzung und Aufbau der Arbeit
Ziel ist es eine Übersicht der gängigen Motivationstheorien im Modell vorzustellen und an einigen praktischen Beispielen Bezüge zur Arbeitswelt herzustellen. Bei den Gruppen von Motivationsmodellen sind Prozessmodelle und Inhaltsmodellen zu unterscheiden. Gegenstand dieser Untersuchung sind ausschließlich die Prozessmodelle. Als Leitmodell fungiert die Theorie des Handlungsantriebsverlaufs auch bekannt als das Rubikon-Modell von H. Heckhausen. Mit dieser ist es möglich die weiteren Modelle anhand des zeitlichen Verlaufs sinnvoll einzugliedern. Aufgrund der Vielzahl der Theorien und des begrenzten Rahmens wird hierfür eine repräsentative Auswahl getroffen.
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1 Vorwort
1.1 Einführung in die Problemstellung
1.2 Zielsetzung und Aufbau der Arbeit
2 Begrifflichkeiten
3 Leitmodell der Prozesstheorien
4 Wählen – prädezisionale Phase
4.1 Erwartungs-mal-Wert-Theorien
4.2 Modell der Risikowahl
4.3 Valenz-Instrumentalitäts-Erwartungs-Theorie (VIE) nach Vroom
5 Zielsetzung – präaktionale Phase
5.1 Zielsetzungstheorie
5.1.1 Zielformulierung
5.1.2 Zielbindung
5.1.3 Selbstwirksamkeit und Feedback
6 Handeln – aktionale Phase
6.1 Handlungskontrolle
6.2 Handlungs- und Lageorientierung
6.3 Ausführungskontrolle
7 Bewerten – postaktionale Phase
7.1 Kausalattribution
7.2 Gerechtigkeit
7.2.1 Verteilungsgerechtigkeit
7.2.2 Verfahrensgerechtigkeit
8 Resümee
Quellenangaben