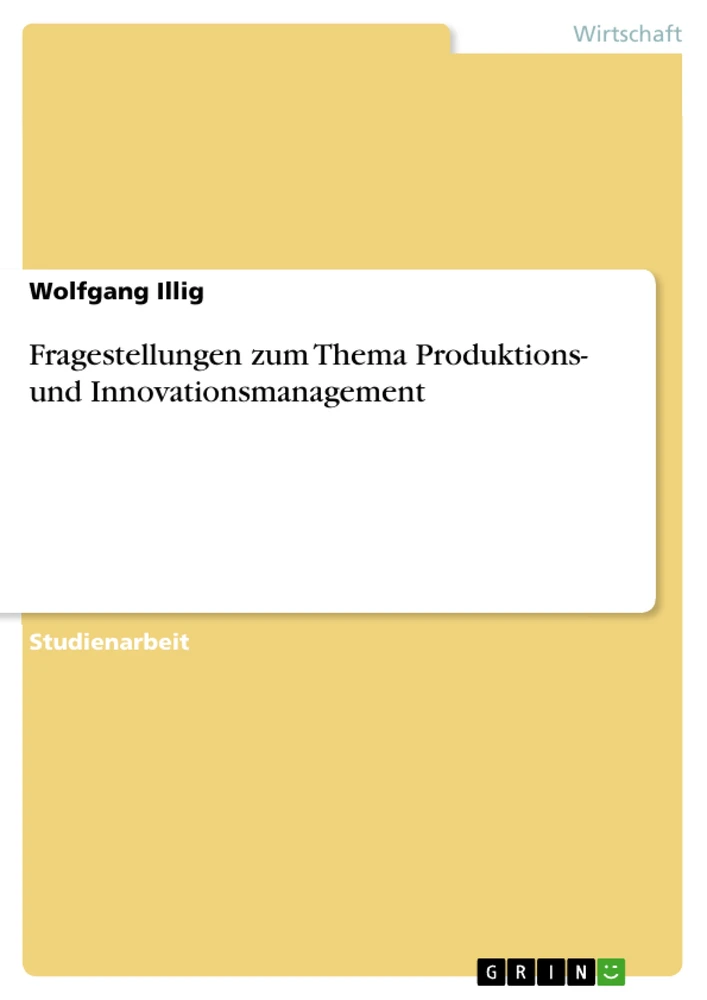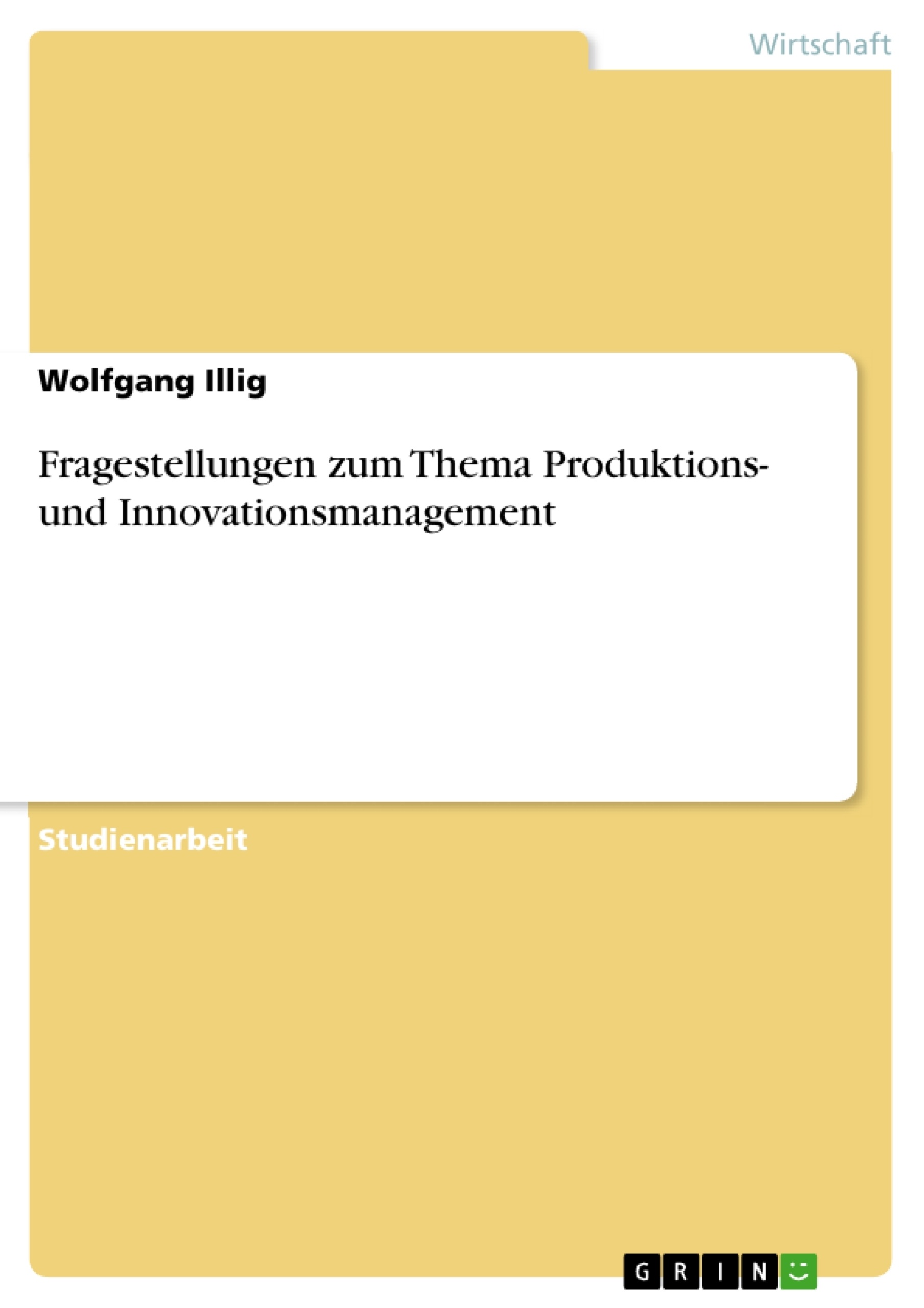In dieser Ausarbeitung zum Fach „Produktions- und Innovationsmanagement“ sollen die folgenden Fragestellungen ausgearbeitet werden:
A.
Was sind die Elemente eines effektiven Systems für das Management von Innovationen in den international tätigen Unternehmen?
B.
Inwieweit kann Innovation als Schlüsselfaktor der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Unternehmen gesehen werden?
C.
Wie kann die Produktion (im weiteren Sinne der Wertschöpfungsprozess) eine zentrale Rolle zur Sicherung von Innovationsvorteilen für europäische Unternehmen spielen?
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
1. Problemstellung
2. Vorgehensweise
3. Allgemeine Erläuterungen
3.1. Erläuterung von Innovation
3.2. Erläuterung von Innovationsmanagement
3.3. Erläuterung von Produktion
3.4. Erläuterung von Produktionsmanagement
4. Was sind die Elemente eines effektiven Systems für das Management von Innovation in den international tätigen Unternehmen?
4.1. Erläuterung weiterer Begrifflichkeiten
4.1.1. Effektive Systeme
4.1.2. international tätige Unternehmen
4.2. Darstellung der Elemente
4.2.1. Ganzheitliche Ausrichtung des Unternehmens auf Innovation
4.2.2. Spezialisierung der Innovationstätigkeit
4.2.3. Koordination der Innovationstätigkeit
4.2.4. Bekämpfen und Überwinden von Widerständen gegen Innovation
4.3. Fazit und Schlussfolgerung
5. Inwieweit kann Innovation als Schlüsselfaktor der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Unternehmen gesehen werden?
5.1. Erläuterung weiterer Begrifflichkeiten
5.2. Schlüsselfaktor Innovation hinsichtlich der Wettbewerbsfähigkeit
5.3. Fazit und Schlussfolgerung
6. Wie kann die Produktion (im weiteren Sinne der Wertschöpfungsprozess) eine zentrale Rolle zur Sicherung von Innovationsvorteilen für europäische Unternehmen spielen?
6.1. Erläuterung weiterer Begrifflichkeiten
6.2. Sicherung von Innovationsvorteilen durch die Produktion
6.2.1. Kontinuierlicher Verbesserungsprozess
6.2.2. Kaizen
6.2.3. Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse
6.3. Fazit und Schlussfolgerung
7. Abschließendes Fazit / abschließende Schlussfolgerung
Literaturverzeichnis