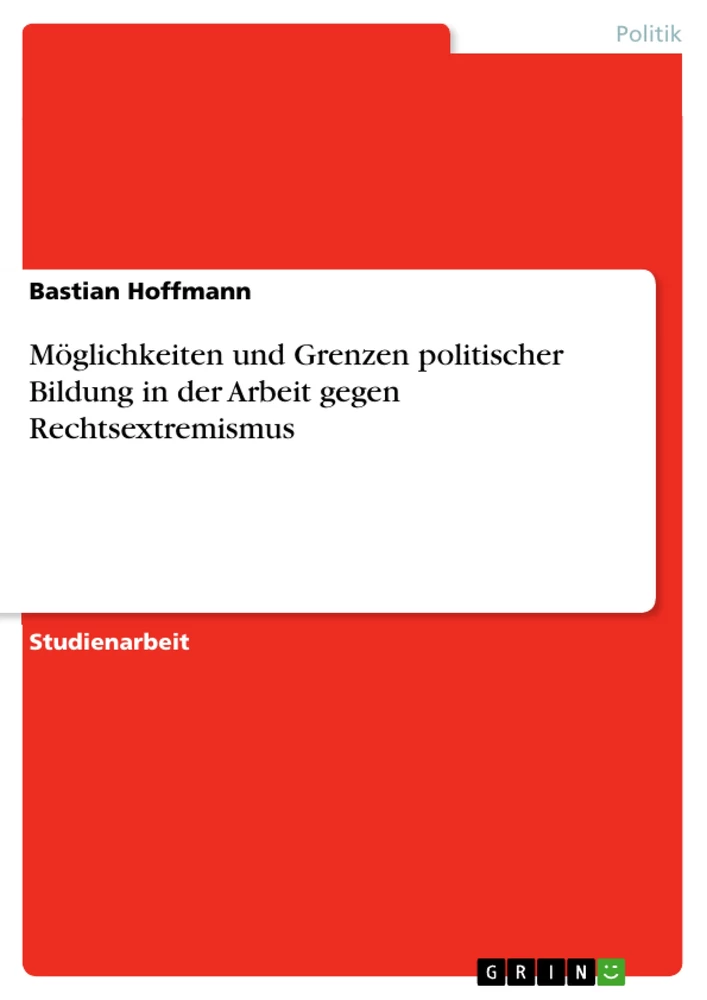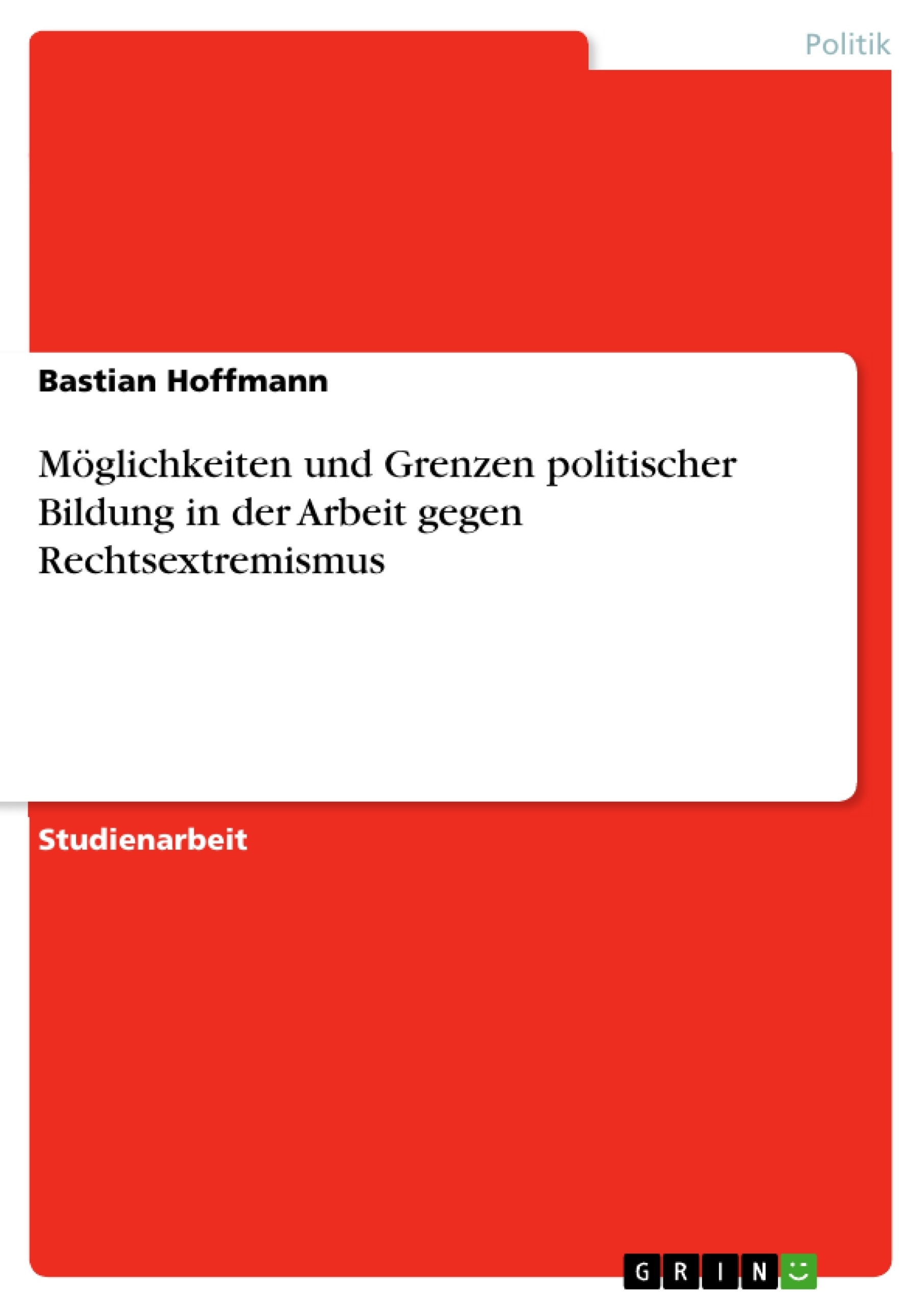„Rechtsextremismus ist ein gesellschaftliches Problem, das [...] mit präventiven Maßnahmen […] bekämpft werden muss“ (zit. FDP-Fraktion des Deutscher Bundestags 2009: 1). So ist der Beginn einer kleinen Anfrage der FDP-Fraktion vom 9. Februar 2009 im Deutschen Bundestag formuliert, die Präventions- und Ausstiegsprogramme aus dem Rechtsextremismus thematisiert. Hierin zeigt sich, dass das Problem des Rechtsextremismus mitten in der Gesellschaft sowohl vorhanden ist, als auch als solches erkannt wird.
Einen großen Teil der Maßnahmen, die sich präventiv mit der Problematik und Lösungsansätzen beschäftigen, sind die pädagogischen Strategien und Programme gegen Rechtsextremismus aus. Einen Teil dieser Arbeit wiederum nimmt die politische Bildung ein. Diese geht davon aus, dass jeder Mensch durch soziale Beziehungen in Gesellschaft und Staat eingebunden ist und während seiner politischen Sozialisation eigene Positionen und dezidierte Einstellungen zu seinem politischen Umfeld entwickelt (Mickel 2007: 422). Durch verschiedene Methoden und Ansätze kann Einfluss auf die Sozialisation des Menschen genommen werden. Eben hierin besteht die Möglichkeit der politischen Bildung bei der Arbeit gegen Rechtsextremismus.
Da sich das Selbstverständnis politischer Bildung seit den Anfängen der Bundesrepublik Deutschland jedoch immer wieder gewandelt hat und erst in der Konferenz von Beutelsbach einen Minimalkonsens gefunden wurde, existiert ein gewisser Spielraum, in dem sich politische Bildung in ihrer Arbeit gegen Rechtsextremismus bewegen kann, aber auch muss. Die Frage, die in dieser Arbeit untersucht werden soll, ist also worin genau diese Möglichkeiten aber auch Grenzen der politischen Bildung in ihrer Arbeit gegen Rechtsextremismus liegen.
Nach der Erläuterung des theoretischen hintergrundes wird der politikdidaktisch normative Rahmen vorgestellt, in dem sich jede Form der politischen Bildung bewegen soll. Im weiteren Verlauf werden konkrete Möglichkeiten vorgestellt, die die Politische Bildung in ihrer Arbeit gegen Rechtsextremismus hat. Diese sollen alle unter den erwähnten normativen Forderungen betrachtet werden. Weiterhin werden die Grenzen betrachtet, an welche die politische Bildung in ihrer Arbeit stößt und die überwunden werden müssen.
Zum Abschluss soll ein bewertender Überblick über die Möglichkeiten und Grenzen geschaffen und auch ein Ausblick über die Zukunft der politischen Bildung im Hinblick auf die Arbeit gegen Rechtsextremismus gegeben werden.
Gliederung
1. Einleitung
2. Theoretische Grundlagen
3. Selbstverständnis von politischer Bildung
4. Möglichkeiten politischer Bildung gegen Rechtsextremismus
4.1 Historisch politische Aufklärung
4.2 Aufklärung zur aktuellen Politik
4.3 Menschenrechtspädagogik
4.4 Stärkung von demokratischen Strukturen
5. Methodische Zugänge
6. Grenzen politischer Bildung gegen Rechtsextremismus
6.1 Erreichen der Zielgruppen
6.2 Strukturen der Lernorganisationen
6.3 Fehlende Anregung von Bildungsprozessen beim kognitvem Lernen
6.4 Tiefe Verankerung von Vorurteilen
7. Schlussbetrachtung und Bewertung
Literatur