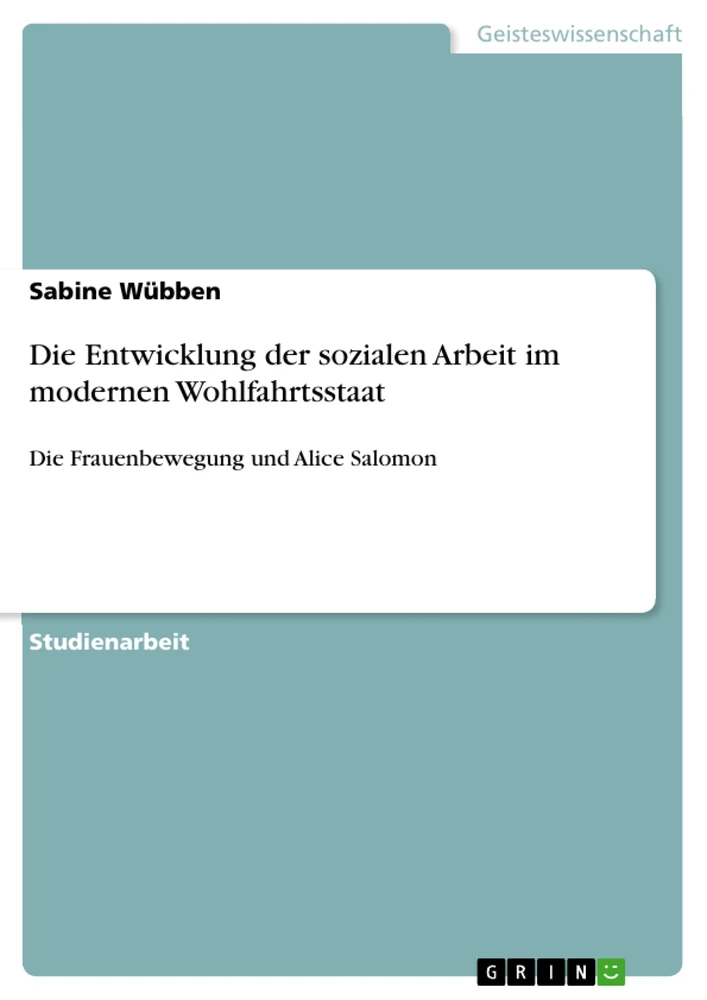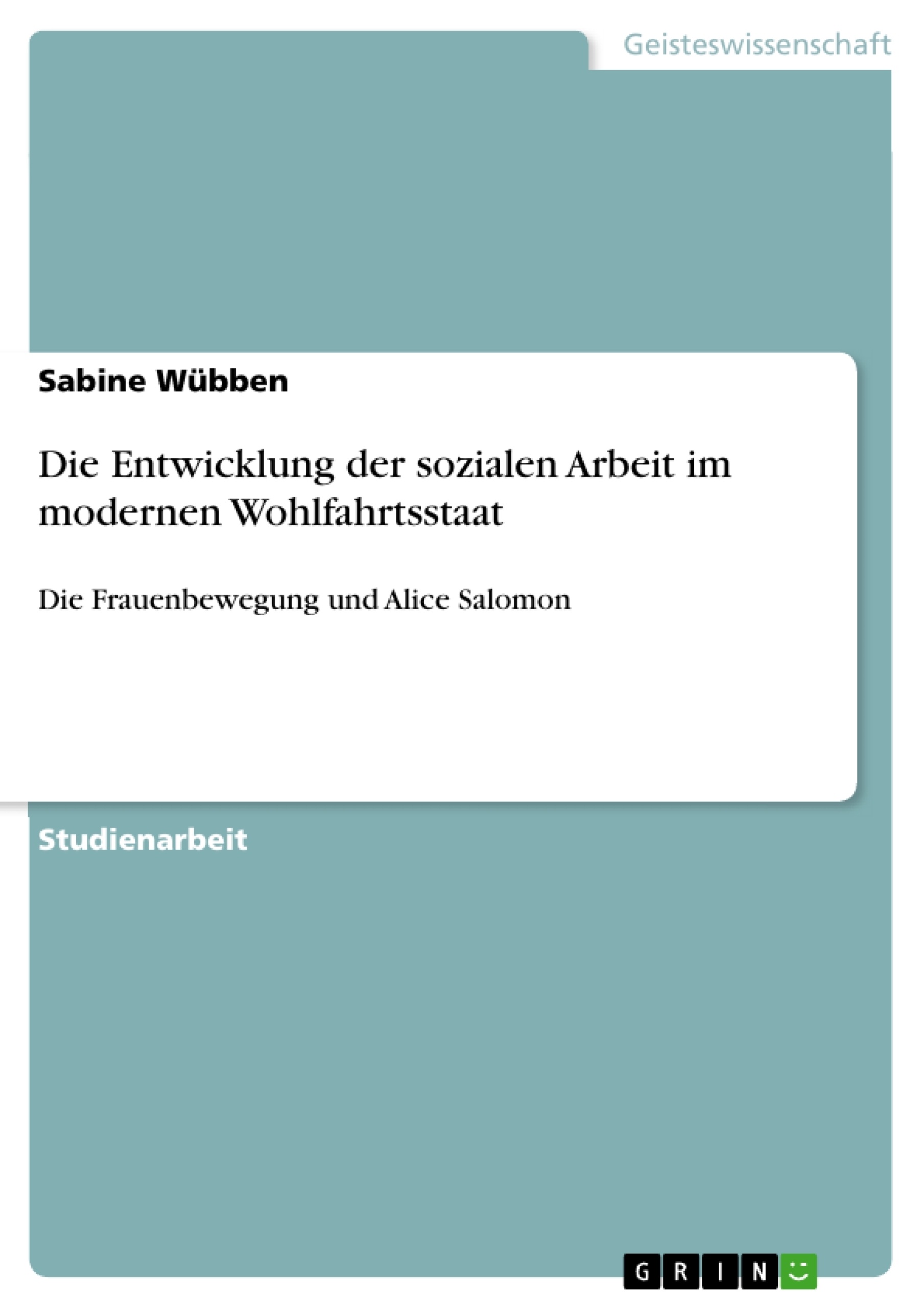Diese Hausarbeit behandelt das Thema der „bürgerlichen Frauenbewegung“ mit Bezug auf Alice Salomon - eine bedeutende Persönlichkeit, die die Frauenbewegung zu Beginn des 20. Jahrhunderts prägte, insbesondere in der Weimarer Republik. Im ersten Teil werden wir eine Historische Einordnung vornehmen, die mit der Epoche der Aufklärung beginnt und die Schritte der Entwicklung der sozialen Arbeit anhand der Entwicklung zu einem demokratischen Staat reflektiert. Im Zweiten Teil werden wir zunächst einen Blick auf die Frauenbewegung werfen, um dann genauer auf die bürgerliche Frauenbewegung und Alice Salomon, sowie deren Werke und Wirkung auf die bürgerliche Frauenbewegung und den Beginn der sozialen Arbeit einzugehen. Zum Schluss unserer Hausarbeit werden wir die Entwicklung der Frauenbewegung und der sozialen Arbeit in der NS-Zeit und in der Bundesrepublik Deutschland genauer betrachten und ein persönliches Fazit zu der damals entstandenen Entwicklung geben.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Historische Einordnung
2.1. Von der Aufklärung zum Deutschen Reich
2.2. Vom 1. Weltkrieg zur Weimarer Republik
3. Die bürgerliche Frauenbewegung
3.1. Historische Fakten zur Frauenbewegung
3.2. Die Bürgerliche Frauenbewegung
3.3. Alice Salomon
4. Entwicklung während & nach der NS-Zeit
4.1. Die NS-Zeit
4.2. Soziale Arbeit in der BRD
5. Fazit
I. Grundlagentexte
II. Weitere Literatur:
III. Internetquellen: