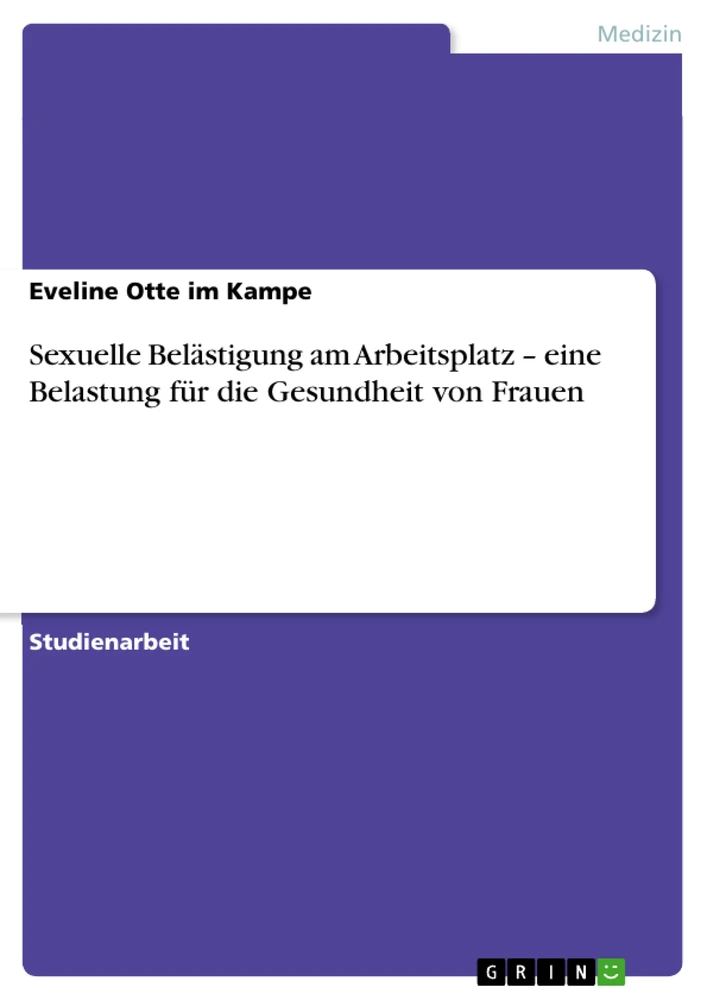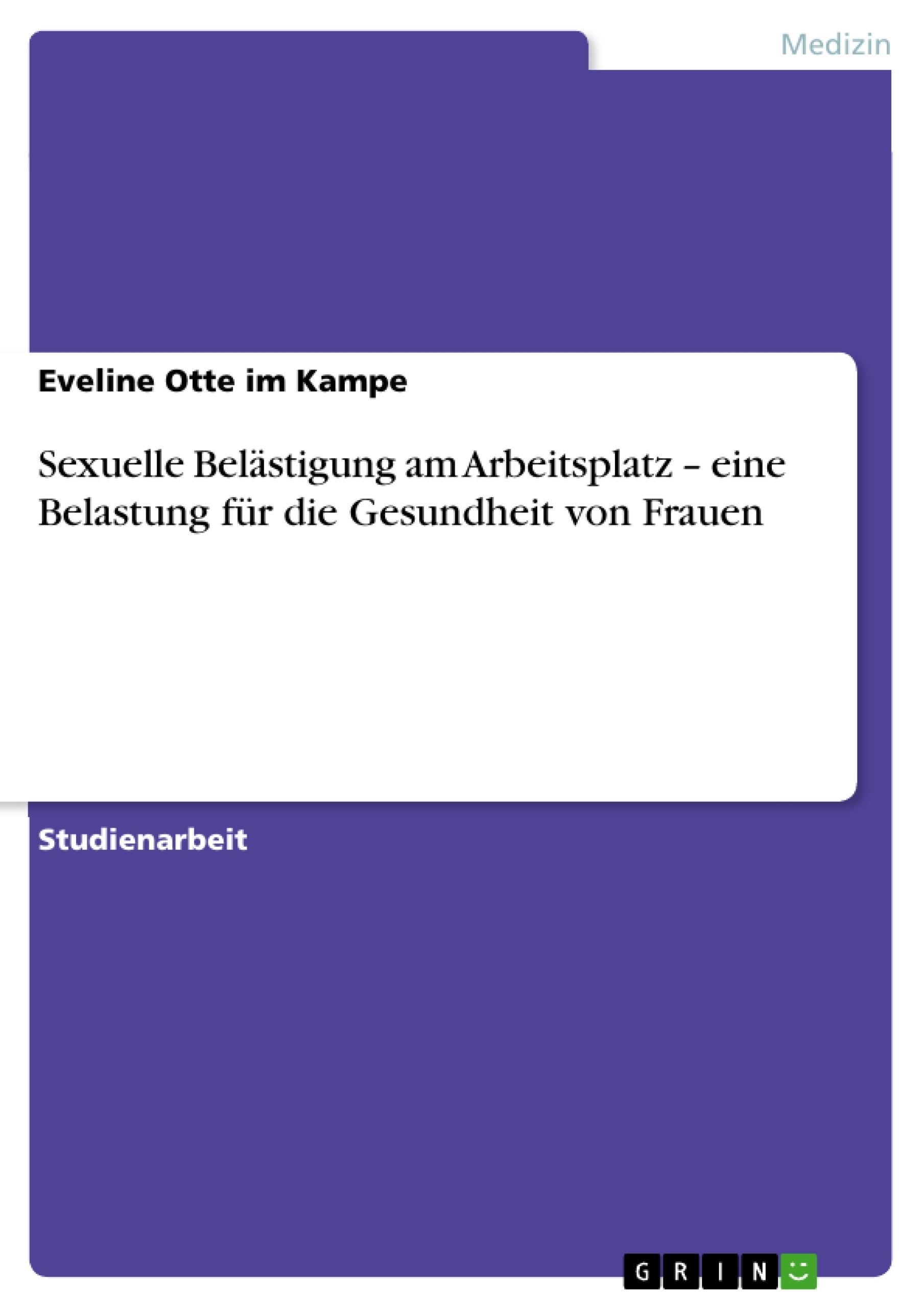Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz ist keine Ausnahmeerscheinung sondern eine stark verbreitete und verdeckte Form von sexueller Gewalt und geschlechtsspezifischer Diskriminierung. Sie existiert, seitdem Frauen erwerbstätig sind. Bereits 1896 forderte das „Centralblatt für Sozialpolitik“ den Schutz der Arbeiterinnen vor den unsittlichen Anträgen ihrer Kollegen (Tebart, 1998). Zunehmende Berücksichtigung bekommt das Problem seit Studien in den 80er Jahren, nachdem es jahrzehntelang tabuisiert worden ist. Trotzdem findet sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz immer noch tagtäglich in verschiedenen Formen statt (Hugo, 2007).
Ich habe dieses Thema gewählt, weil mich interessiert, welche Folgen durch sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz für die Gesundheit und Lebensqualität der Frauen entstehen können und welche Maßnahmen es gibt, um den Betroffenen zu helfen. Dazu soll die vorliegende Arbeit einen Einblick geben.
Es wird auf das Ausmaß und verschiedene Formen von sexueller Belästigung am Arbeitsplatz eingegangen und es werden Ursachen und Funktionen erläutert. Das Kapitel „Folgen von sexueller Belästigung“ soll zeigen, welche Auswirkungen es u.a. auf die Gesundheit der Frauen haben kann. Außerdem werden die wichtigsten rechtlichen Regelungen zum Tatbestand der sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz genannt und es werden Handlungsmöglichkeiten für die Betroffenen und den Betrieb vorgeschlagen.
Täter und Opfer von sexueller Belästigung können Männer und Frauen sein. Da Männer selten Opfer und Frauen selten Täter sind (Müller und Schröttle, 2004), habe ich entschieden, mich in der vorliegenden Arbeit auf Frauen als Opfer und Männer als Täter zu konzentrieren.
Inhaltsverzeichnis
1 EINLEITUNG
2 AUSMAß UND FORMEN VON SEXUELLER BELÄSTIGUNG
3 URSACHEN UND FUNKTIONEN VON SEXUELLER BELÄSTIGUNG
4 SEXUELLE BELÄSTIGUNG - EIN GESUNDHEITSRISIKO
5 RECHTSLAGE
6 GEGENWEHR DER BETROFFENEN UND UNTERSTÜTZUNG IM BETRIEB
6.1 REAKTIONEN UND HANDLUNGSMÖGLICHKEITEN DER BETROFFENEN
6.2 REAKTIONEN UND HANDLUNGSMÖGLICHKEITEN IM BETRIEB
7 FAZIT
8 LITERATURVERZEICHNIS