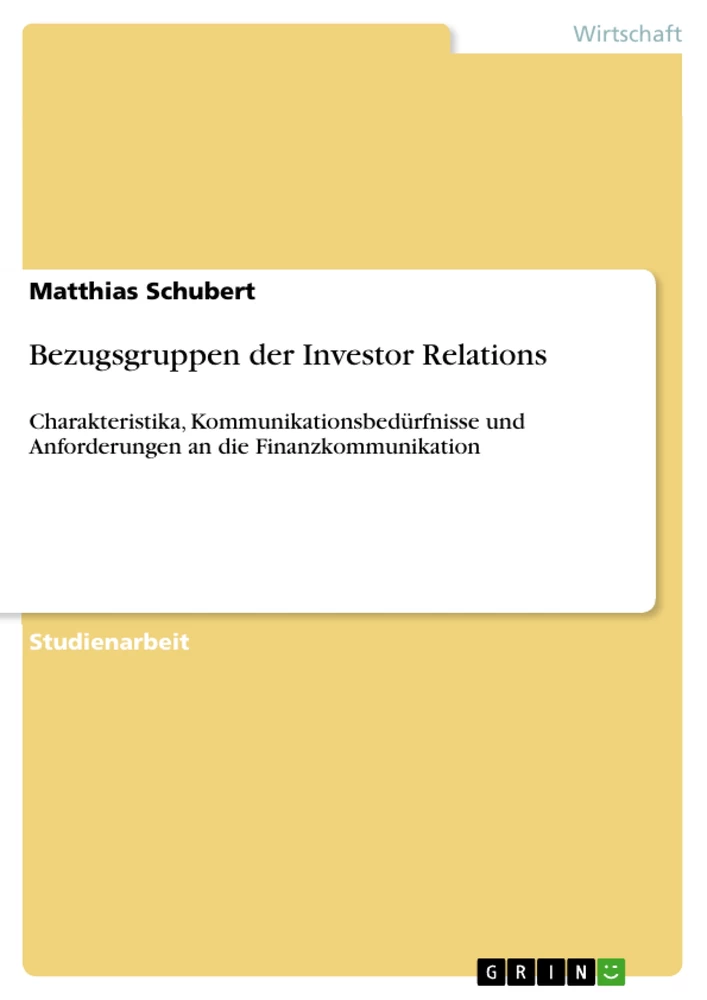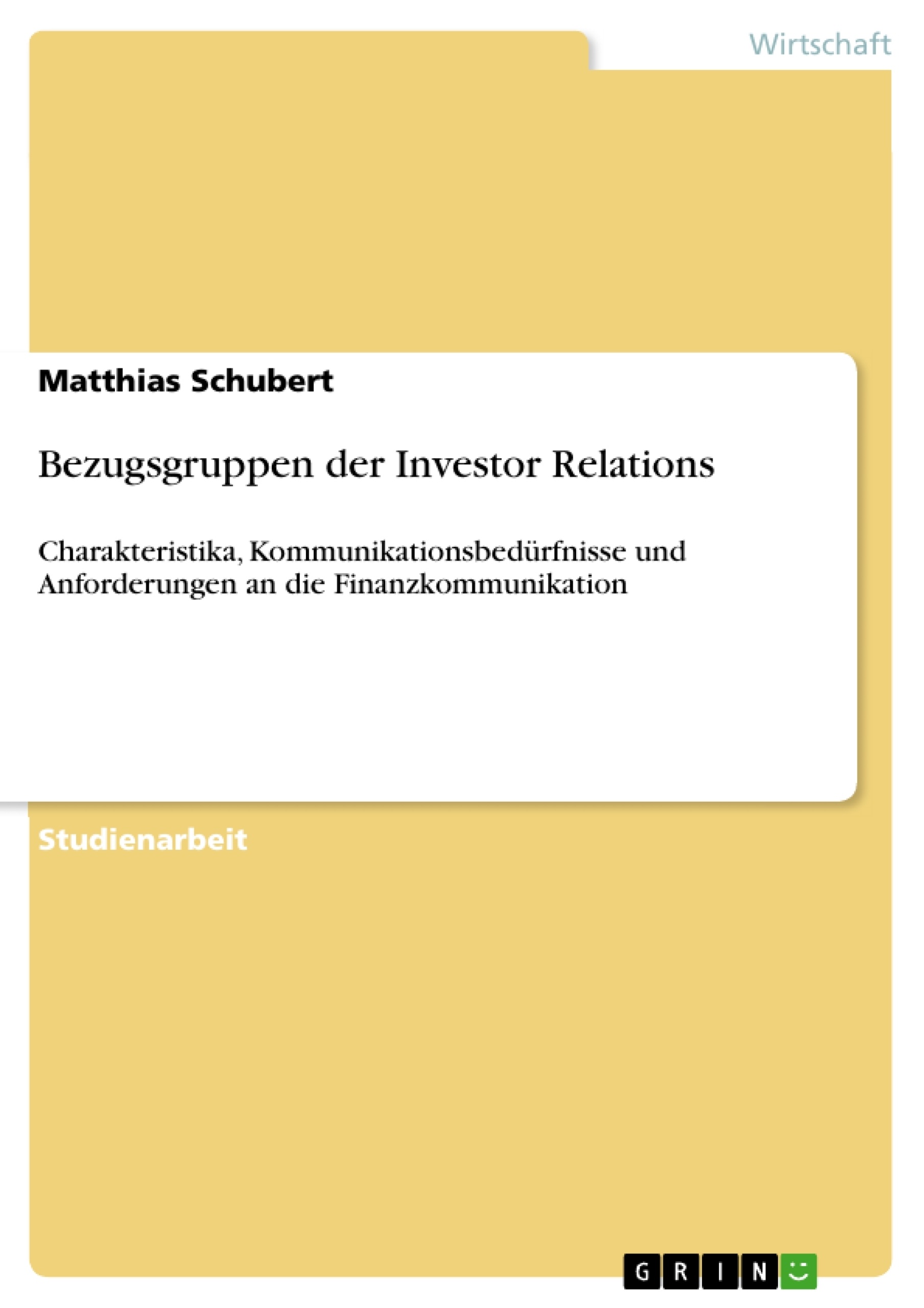Die Kommunikationsintensität an Finanzmärkten ist aufgrund des öffentlichen Charakters von Börsen qualitativ und quantitativ anders geartet als an Gütermärkten. Finanzmärkte sind sehr transparent und Aushandlungsprozesse, die an der Börse stattfinden, sind hochkommunikativ. Gleichzeitig hat man es dort mit einem imaginären Verhandlungspartner zu tun, den man nicht kennt, sieht oder hört. Der Aktienmarkt ist daher ein gutes Beispiel, wie in weitgehend virtueller Kommunikation und vielfach ohne real berechenbare Gegengrößen Wertsteigerungen und –verluste allein auf Grund von Erwartungen, Fantasie, Einschätzungen oder gar Launen entstehen.
Da die Bezugsgruppen von börsennotierten Unternehmen unterschiedliche Informationsbedürfnisse und Kommunikationsverhalten aufweisen, würde eine unstrukturierte Informationsflut ihre Wirkung verfehlen. Darum ist es die Aufgabe von Investor Relations, Informationen bezugsgruppengerecht aufzubereiten.
In der Arbeit werden die Besonderheiten der wichtigsten externen Bezugsgruppen in der Finanzkommunikation dargestellt. Dazu werden zunächst die zentralen Begriffe dieser Arbeit erläutert und definiert, um im Anschluss die wichtigsten externen Bezugsgruppen der Finanzkommunikation, deren unterschiedliche Charakteristika, Informations- und Kommunikationsbedürfnisse, sowie die daraus resultierenden unterschiedlichen Anforderungen an Investor Relations darzustellen.
Im abschließenden dritten Kapitel wird erläutert, wie trotz dieser unterschiedlichen Anforderungen und Bedürfnisse eine einheitliche Finanzkommunikation mit den Bezugsgruppen realisiert werden kann.
Inhalt
1. Einleitung
1.1. Ziel, Abgrenzung und Aufbau der Arbeit
1.2. Begriffe und Definitionen
1.2.1. Investor Relations
1.2.2. Bezugsgruppen
2. Bezugsgruppen der Investor Relations
2.1. Investoren
2.1.1. Institutionelle Investoren
2.1.2. Private Investoren
2.2. Multiplikatoren
2.2.1. Analysten
2.2.2. Journalisten
3. Equity Story