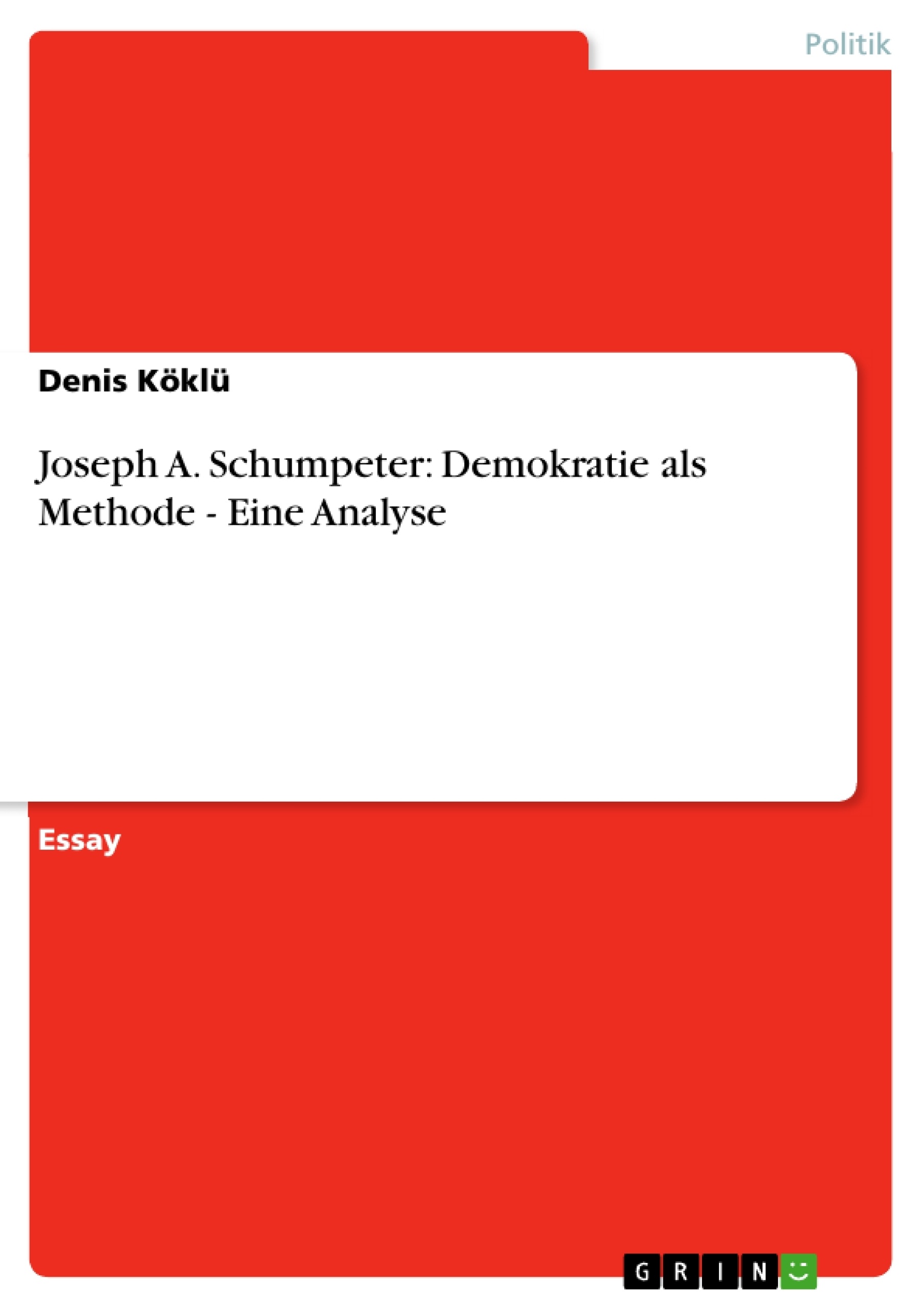Joseph A. Schumpeter artikuliert im zweiundzwanzigsten Kapitel des Werkes "Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie" seine eigene Theorie der Demokratie, die der sogenannten klassischen Lehre der Demokratie diametral entgegengesetzt ist. Letztere geht nach den Anführungen des Autors von der Prämisse aus, dass Volksvertreter einzig als für das Gemeinwohl ausführende Organe fungieren, politische Entscheide in der Hand der Wahlberechtigten liegen.
Schumpeters Demokratietheorie hat indes eine ganz andere Dimension. Während die klassische Theorie, wie angeführt, ihren Ursprung in der Umsetzung des Volkswillen durch Kandidaten hat, die Macht somit beim Volke liegt, beruht die des Autors auf der Entscheidungsbefugnis gewählter Personen. Diese wird besagten Personen durch einen Konkurrenzkampf um die Stimmen des Volkes zu eigen. Die Demokratie zeigt sich hierbei vorrangig als Methode: Einzelne zu wählen und diesen Macht zu übertragen.
Joseph A. Schumpeter: Demokratie als Methode - Eine Analyse
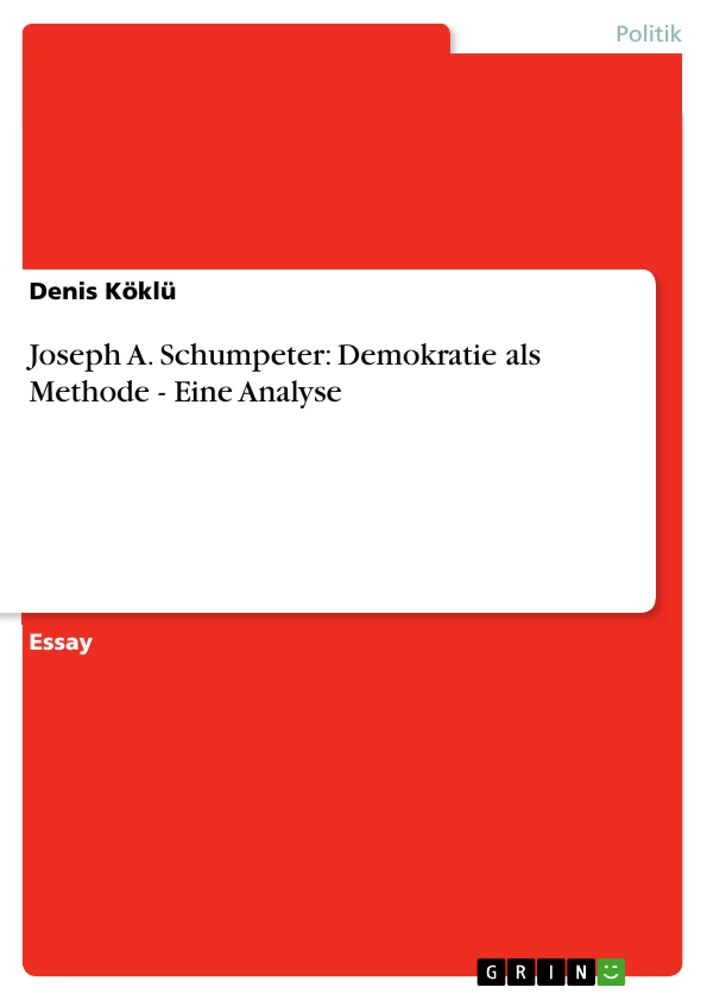
Essay , 2010 , 6 Seiten , Note: 1,3
Autor:in: Denis Köklü (Autor:in)
Politik - Politische Theorie und Ideengeschichte
Leseprobe & Details Blick ins Buch