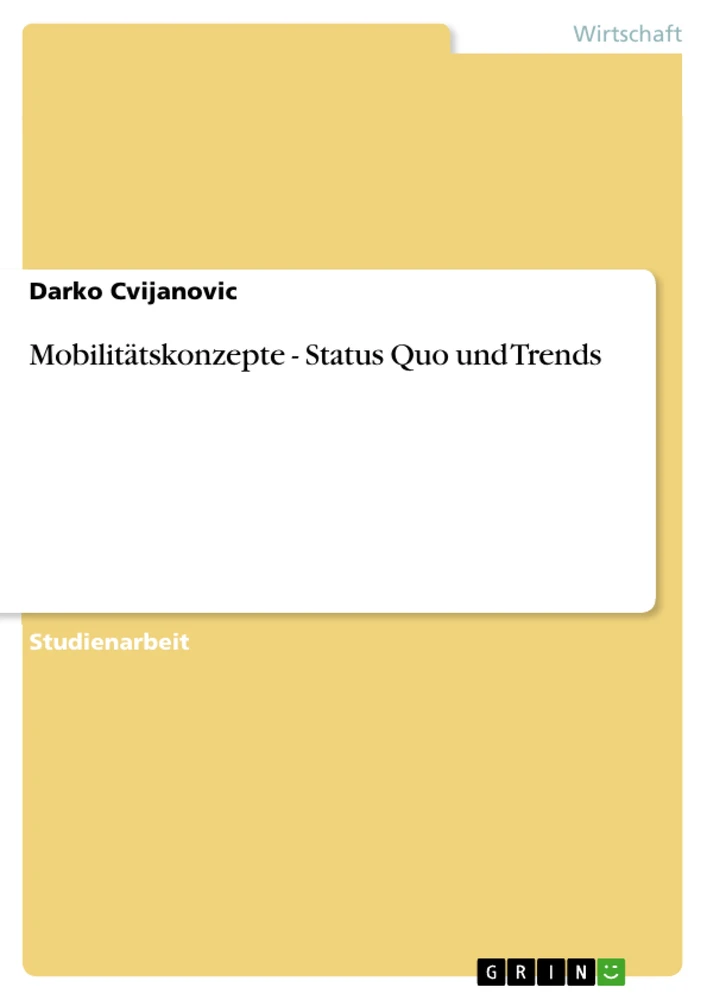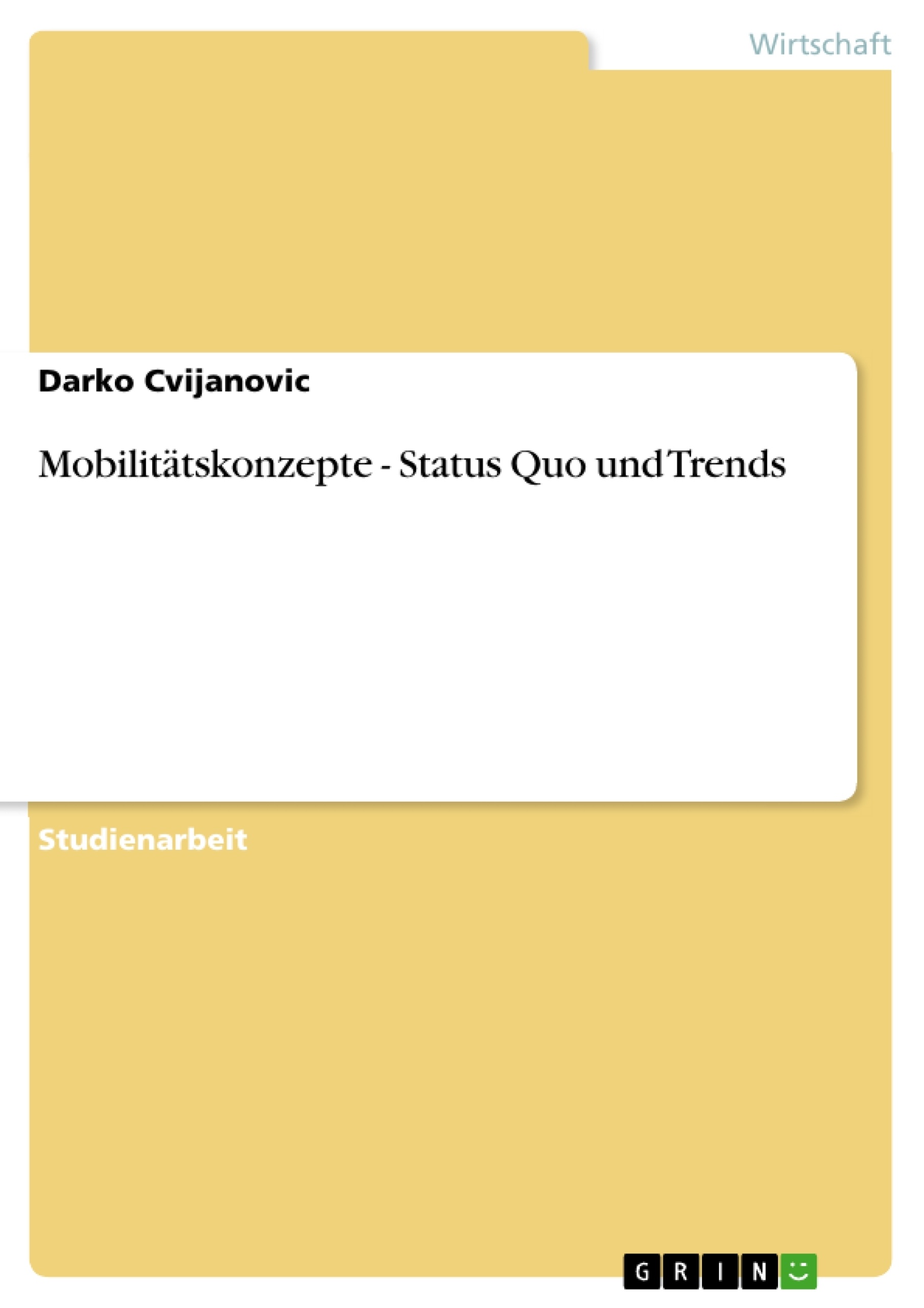1. Einführung
Wie man der Erhebung des Statistischen Bundesamtes entnehmen kann, liegt der Anteil des Pkw an der Personenverkehrsleistung bei etwa 80%. Damit stellt der Pkw das dominierende Verkehrmittel dar. Auf Grund des hohen Maßes an Flexibilität und Individualität ist das Auto somit des Deutschen liebstes Verkehrsmittel. Doch wie wirken sich in der heutigen Zeit strukturelle, wirtschaftliche, verkehrpolitische oder ideelle Veränderungen der Rahmenbedingungen auf die Mobilitätsnutzung aus? Welche Konzepte der Mobilität sind in der Zukunft gefragt, welche Verkehrsmittel werden wir nutzen? Welche Antriebs- und Kommunikationstechnologien, welche Arten von Dienstleistungen werden unsere vernetzte, mobile Zukunft prägen? Die folgende Untersuchung „Mobilitätskonzepte – Status Quo und Trends“ soll Antworten auf diese Fragestellungen geben und mögliche Zukunftsszenarien und Berücksichtigung verschiedener Einflüsse aufzeigen.
1.1 Problemstellung und Zielsetzung
Das Mobilitätsverhalten der Menschen und die Mobilitätskonzepte befinden sich in einem Wandlungsprozess. Ursächlich für diesen Wandel in der Mobilität ist eine Vielzahl von Faktoren mit unterschiedlichen Auswirkungen. Ziel dieser Ausarbeitung ist, vom heutigen Status Quo der Mobilitätskonzepte ausgehend unterschiedliche Szenarien zu entwickeln, die unter Berücksichtigung der verschiedenen Veränderungstreiber mögliche Entwicklungen der zukünftigen Mobilität und ihre Eintrittswahrscheinlichkeiten beschreiben.
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1. Einführung
1.1 Problemstellung und Zielsetzung
1.2 Aufbau
2. Status Quo der Mobilitätskonzepte
2.1 Mobilitäts- und Verkehrskonzepte
2.1.1 Mobilität und Verkehr
2.1.2 Mobilitätsmuster und Mobilitätssysteme
2.2 Abgrenzung der Mobilitätskonzepte: Dienstleistungen und Antriebe
2.2.1 Mobilität schaffende Dienstleistungen
2.2.2 Mobilität sichernde Dienstleistungen
2.2.3 Mobilität erweiternde Dienstleistungen
2.2.4 Aus technologischer Perspektive
2.3 State of the Art und künftige Entwicklungen
3. Treiber der Veränderungen
3.1 Verkehrspolitische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen
3.2 Demografischer Wandel
3.3 Wandel im Konsumverhalten
3.4 Urbanisierung
3.5 Technologischer Fortschritt und vernetzte Welt
4. Trends und Szenarien hinsichtlich zukünftiger Mobilitätskonzepte
4.1 Grundlegende Trends
4.2 Veränderte Ausrichtungen und neue Akteure
4.3 Zukunftsszenarien
4.3.1 Szenario 1: „Langsame Anpassung“
4.3.2 Szenario 2: „Stetige Anpassung“
4.3.3 Szenario 3: „Radikaler Wechsel“
5. Bewertung und Ausblick
Literaturverzeichnis