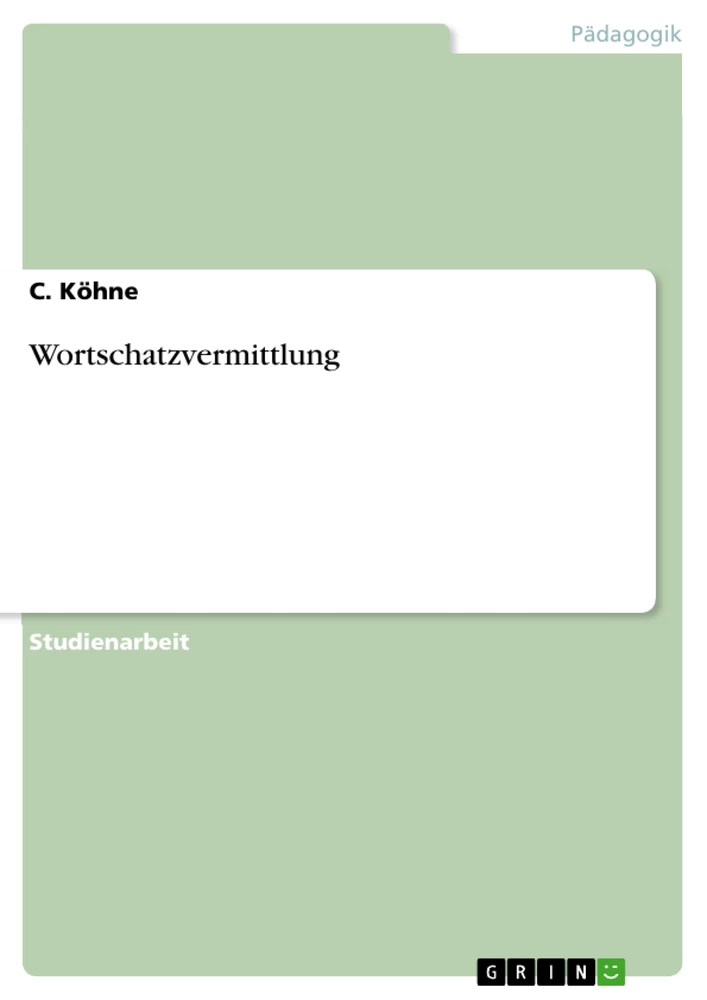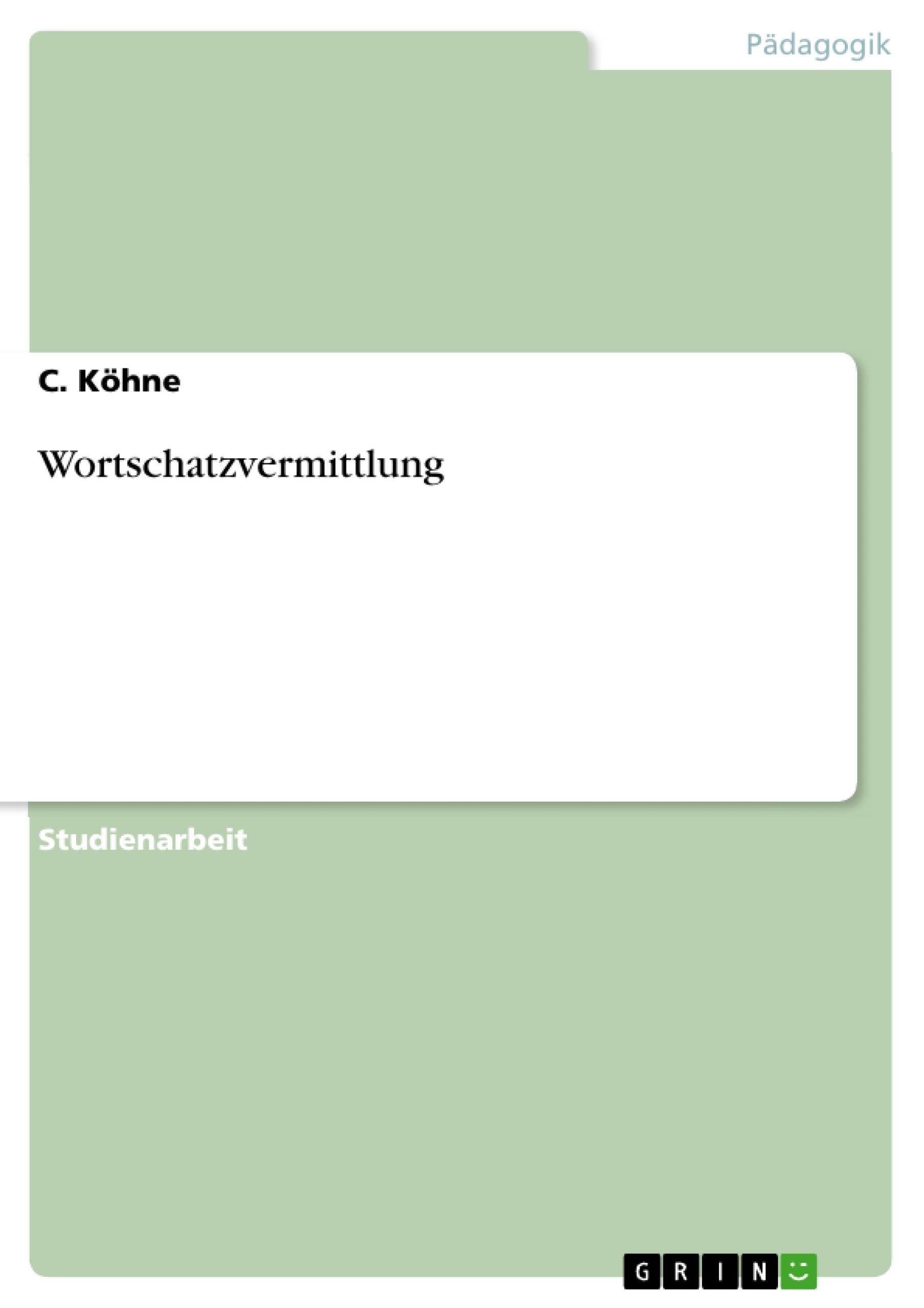Im Zeitalter der fortschreitenden Globalisierung scheint es unabdingbar eine vermehrte und vor allem effektivere Wortschatzarbeit, die nicht nur schulintern stattfinden soll, zu betreiben.
Die Art der Vermittlung des Wortschatzes hat sich im Lauf der Zeit stets gewandelt und sich den Bedingungen der Sprachen und Kulturen angepasst.
In dieser Hausarbeit soll deshalb die Frage untersucht werden, welche Formen der Wortschatzübungen am sinnvollsten für die Vermittlung von Wortschatz bezüglich der Lernbedingungen sind. Dies geschieht zu aller erst im Hinblick auf die historische Entwicklung der Wortschatzübungen.
Auch soll die These analysiert werden, inwiefern die Wortschatzvermittlung als Stütze des interkulturellen Dialoges dienen kann. Dies hat vor allem Konsequenzen für den „Deutsch als Fremdsprache oder Deutsch als Zweitsprache – Unterricht“, deren Umsetzung immer mehr in der Ausbildung der Lehrkräfte Einzug finden. Die Lehrkräfte haben hier nicht nur die Aufgabe der Wortschatzvermittlung und das Beibringen der deutschen Sprache, sie müssen zudem zwei meist sehr unterschiedliche Kulturen auf einen Nenner bringen. Damit ist gemeint, dass sie auf die unterschiedliche Semantik von Begriffen in den verschiedenen Kulturen eingehen und diese versuchen den Schülern zu vermitteln. Hier sollen auch die didaktischen und methodischen Aspekte und Konsequenzen untersucht und ausgewertet werden.
Inhaltsverzeichnis
0) Einleitung
1) Der Begriff „Wortschatz“
1.1) Historie des Vermittelns von Wortschatz
2.) Wortschatzübungen
2.1) Wortbedeutung und Bedeutungsvermittlung
2.2) Grenzen und Probleme der Wortschatzübungen
3.) Konsequenzen für den DaF-Unterricht
4.) Ausblick
Literaturverzeichnis