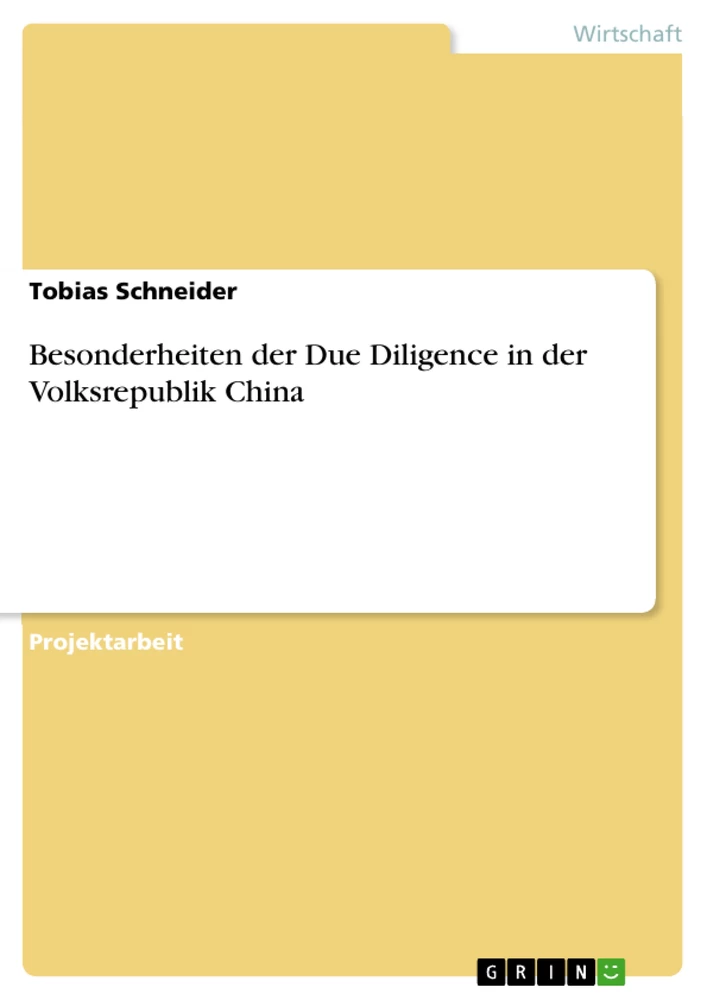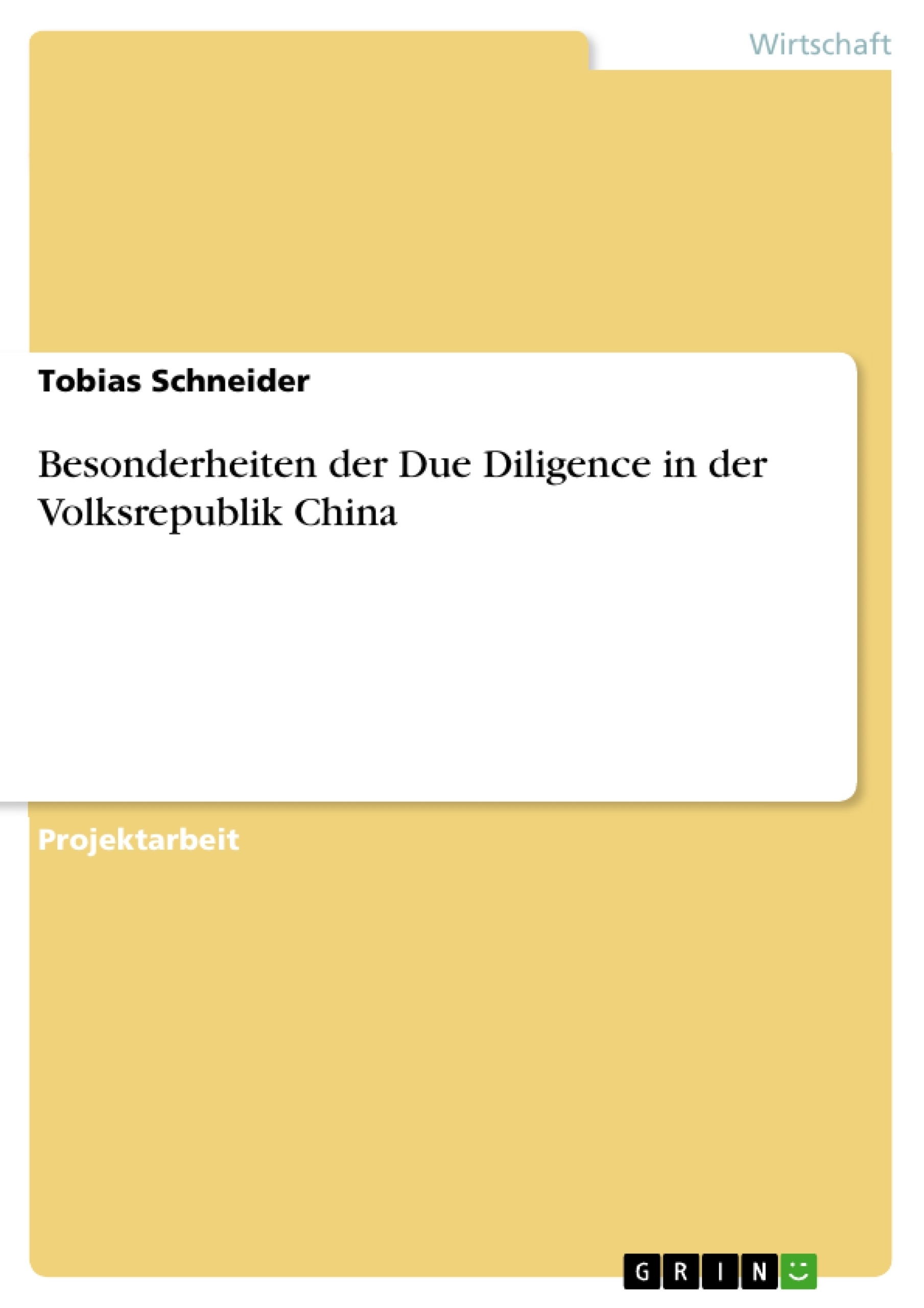Der schnellwachsende chinesische Markt, veranlasste in den vergangenen Jahren zunehmend lokale und internationale Unternehmen sich in China zu positionieren. Die Folge war eine rapide steigende Zahl von Firmenzusammenschlüssen und Firmenübernahmen. Dieses Vorgehen stellt für die meisten europäischen Investoren allerdings immer noch eine große Herausforderung dar, die oft am unterschiedlichen Verständnis für Unternehmensführung und Strukturierung als auch kulturellen Missverständnissen zu scheitern droht. Diese Unerfahrenheit westlicher Wirtschaftakteure im Bezug auf die chinesische Mentalität und deren Wirtschaftsbeziehungen zeigt sich im Übernahmeprozess besonders bei der Bewertung des Zielobjekts, da sich erst hierbei Unternehmensstrukturen und Denkweisen der einzelnen Wirtschaftakteure offenbaren.
Diese Arbeit soll insbesondere einen Einblick über typische Herausforderungen und Unterschiede im Ablauf einer Due Diligence in China geben. Nach einem chinesischen Sprichwort genügt es nicht zum Fluss zu kommen mit dem Wunsch Fische zu fangen, man muss auch das Netz mitbringen. Dieses gilt analog für den Bewertungsprozess in einem chinesischen Unternehmen.
Diese Arbeit soll erläutern worauf während der Durchführung einer Due Diligence in einem chinesischen Unternehmen zu achten ist. Hierfür werden zunächst die grundlegenden Vorgehensweisen nach westlichen Standards erläutert. Im folgenden Teil wird dann auf die speziellen Problemfelder einer Bewertung in China eingegangen um zu analysieren, in welchen Bereichen typischerweise Gefahren unterschätzt werden.
Diese Untersuchung beginnt bei der Beschaffung und vor allem Auswertung chinesischer Finanzdaten, welche trotz der Annäherung an IFRS noch immer nicht westliche Standards erreicht haben und häufig nur unter großem Aufwand überprüft werden können. Hieran schließt sich eine Betrachtung von steuerlichen und rechtlichen Kriterien an, welche sowohl die Praxis der Steuerermittlung als auch den möglichen Einfluss einer Übernahme durch ein ausländisches Unternehmen auf die Steuerlast aufzeigt.
Die Analyse von rechtlichen Problemfeldern konzentriert sich auf Gesetzgebung, Durchsetzbarkeit von Ansprüchen und die Frage der Rechtmäßigkeit von Firmenbesitz und somit dessen Übertragbarkeit. Bei letzterem soll insbesondere überprüft werden welche Formen und von Landnutzungsrechten existieren und inwieweit diese vom Käufer übernommen werden können.
Inhaltsverzeichnis:
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1. Einleitung und Problemstellung
2. Grundlagen der Due Diligence
2.1 Funktionen und Ziele
2.2 Umfang und Struktur
2.3 Spezielle Vorbereitung einer Due Diligence in der Volksrepublik China
3. Herausforderungen an eine Due Diligence in der Volksrepublik China
3.1 Finanzwirtschaftliche Kriterien
3.2 Bilanzielle Kriterien
3.3 Steuerliche Kriterien
3.4 Rechtliche Kriterien
3.5 Strategische Kriterien
3.6 Personelle Kriterien
3.7 Kulturelle Kriterien
3.8 Umweltbezogene Kriterien
4. Praxisbericht von Siemens
5. Fazit
Literaturverzeichnis