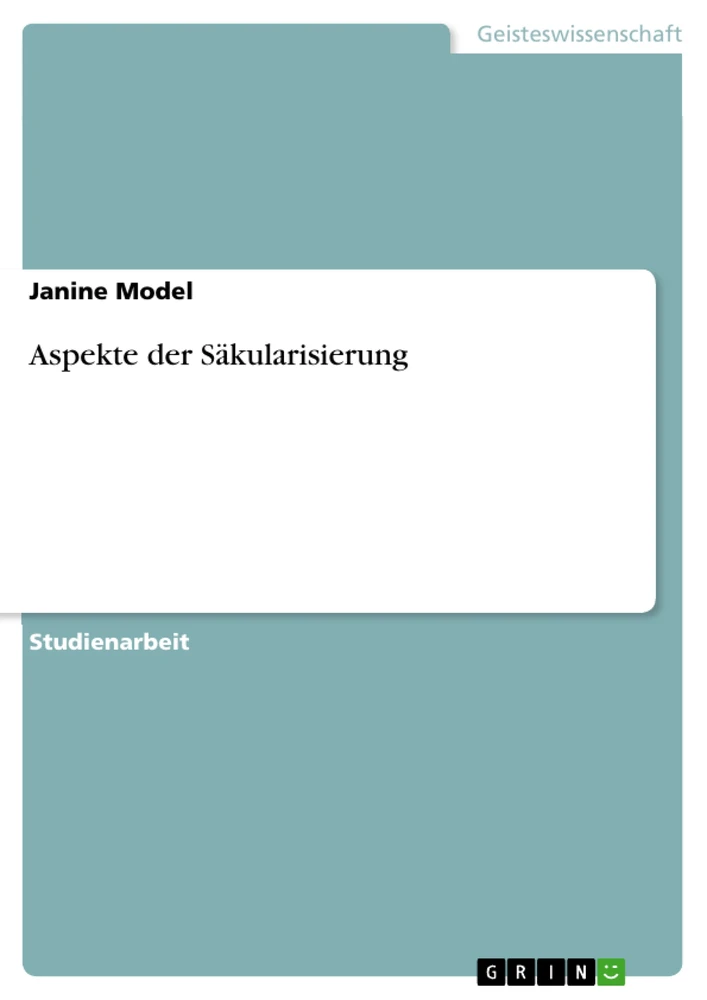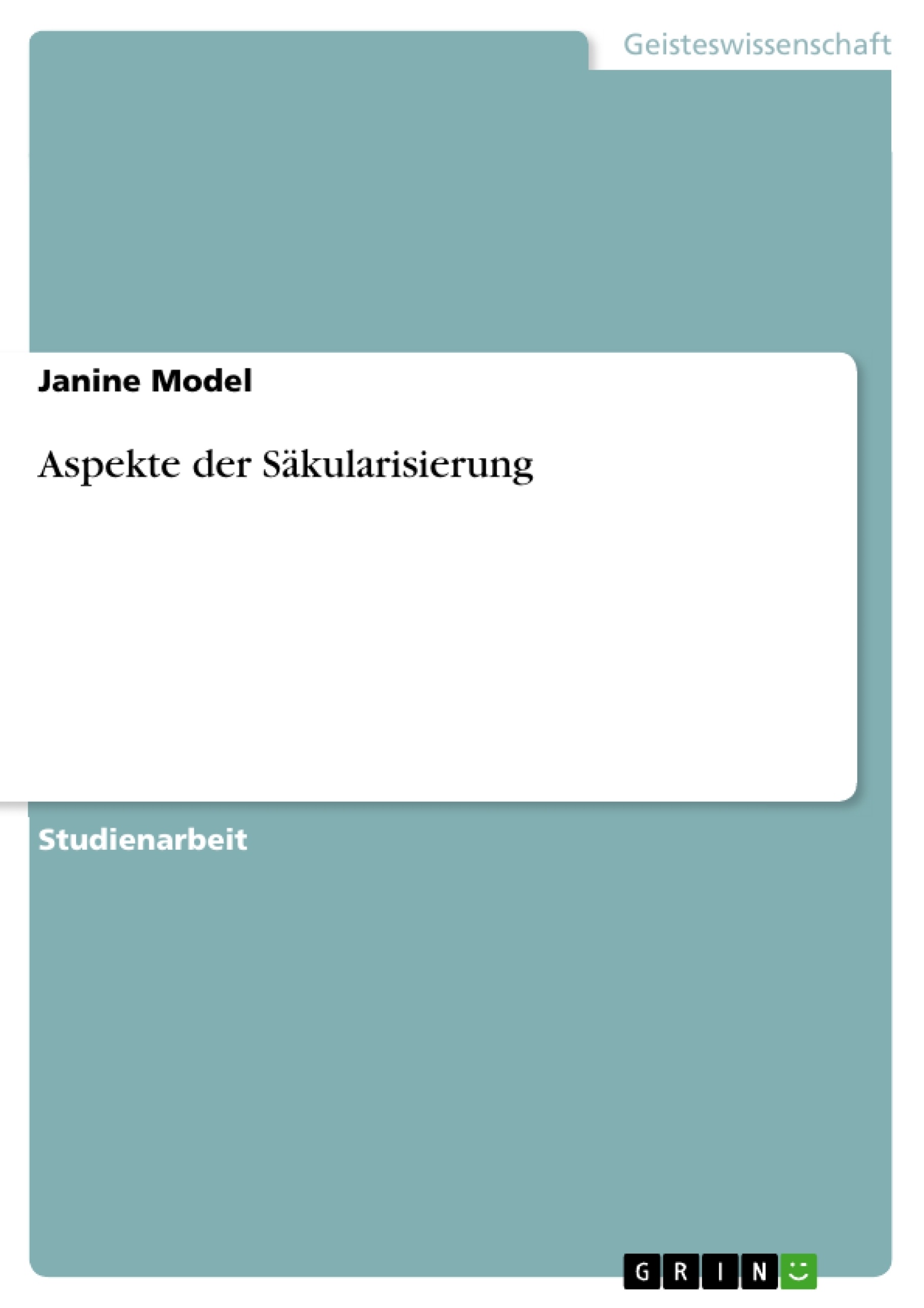The aim of this work is to give a brief overview over the complex topic of 'secularisation'. The subject is introduced by giving a definition of the term 'secularisation'. Further, the concept of a secularised state is specified. In that context, also the relationship between democracy and religion is considered. Furthermore, an answer to the question whether religion is in recurrence or not, is approached. Finally, there is a closer look onto Europe and its position in the secularisation debate.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Der Begriff der Säkularisierung
3. Der säkularisierte Staat
4. Zum Spannungsverhältnis zwischen Religion und Demokratie
5. Rückkehr der Religionen?
6. Die Sonderstellung Europas
7. Schlussbetrachtung