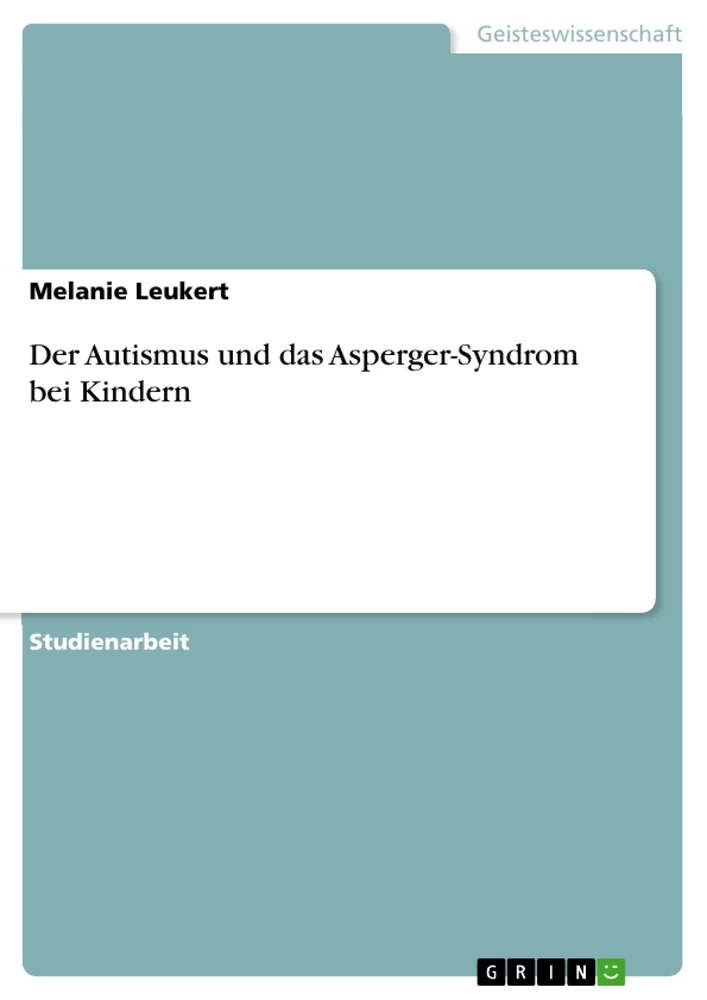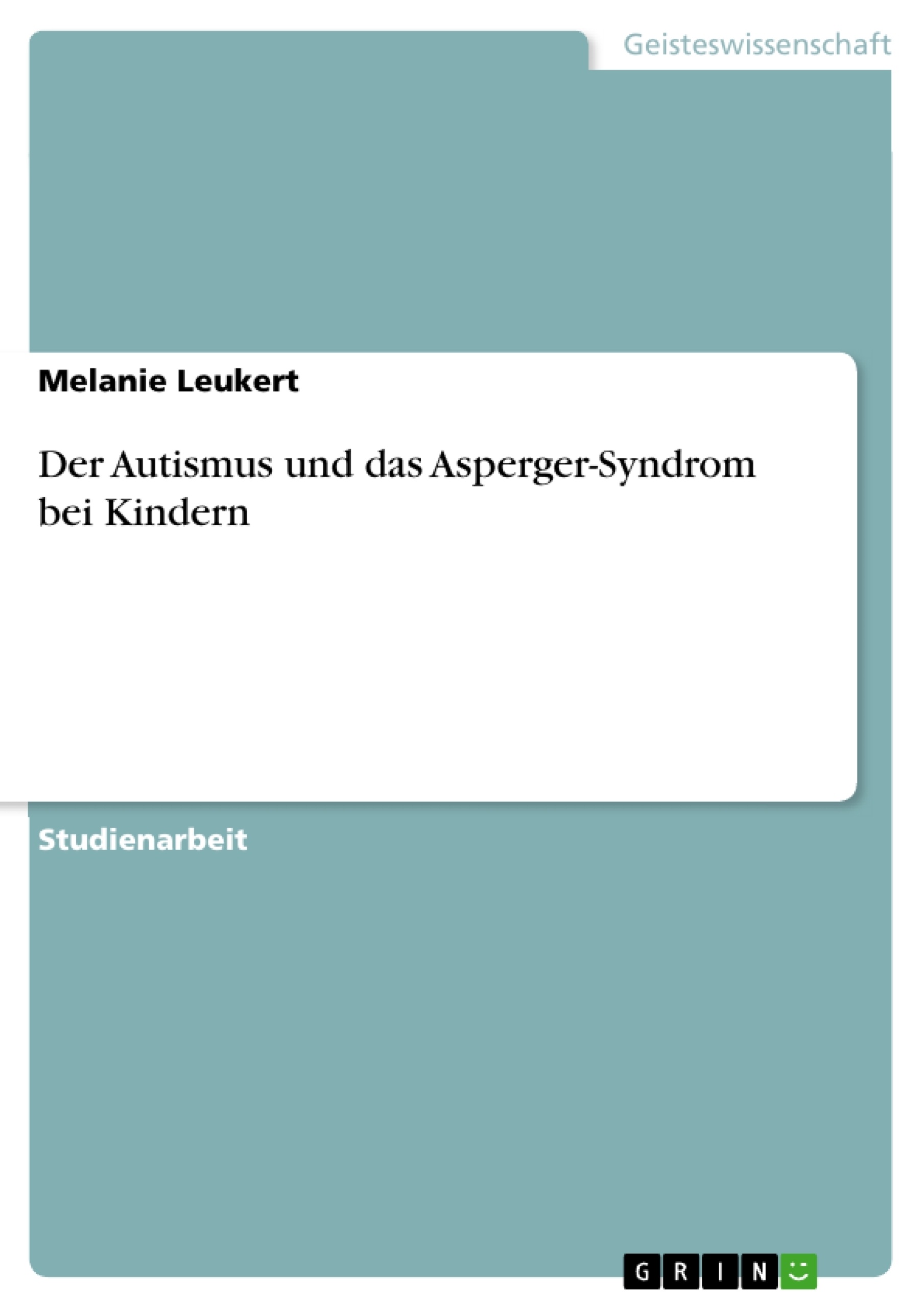Psychologie, Pädagogik und andere Professionen arbeiten bereits seit einigen Jahren an der Förderung autistischer Menschen, um einer Isolation entgegenzuwirken. Die Arbeit mit behinderten Menschen gewinnt in der Sozialen Arbeit zunehmend an Bedeutung, andererseits besteht ein Mangel an qualifizierten SozialarbeiterInnen, welche mit dem Thema Autismus vertraut sind. Es gibt kaum Literatur, Bedarf an Fachwissen und Förderungen von autistischen Menschen steigt jedoch.
Im Mittelpunkt dieser Arbeit soll die Gegenüberstellung von frühkindlichem Autismus und dem Asperger-Syndrom stehen. Ich versuche herauszuarbeiten, wie sich autistische Störungen äußern, beziehungsweise wie SozialarbeiterInnen im Umgang mit erkrankten Kindern und Jugendlichen agieren könnten. Die Forschung hat in den letzten Jahren neue Erfahrungen auf dem Gebiet des Autismus gewonnen, aktuelle Ergebnisse werde ich in den einzelnen Kapiteln erklären. Daraus ergeben sich folgende Fragen, welche ich im Verlauf der Hausarbeit erörtern möchte: Welche Hilfe- und Unterstützungsmöglichkeiten finden Kinder mit der Diagnose Asperger-Syndrom in der Sozialen Arbeit und wie können diese angewendet werden? Was leistet die Soziale Arbeit in Bezug auf die TEACCH-Methode? Gibt es Unterschiede zwischen dem frühkindlichen Autismus und dem Asperger-Syndrom?
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Definitionen
2.1 Autismus
2.2 Frühkindlicher Autismus
2.3 Asperger-Autismus
3 Autismus-Spektrum-Störungen und seine Formen
3.1 Frühkindlicher Autismus
3.1.1 Diagnisekriterien nach ICD-10 und DSM-IV
3.1.2 Epidemiologie
3.1.3 Symptomatik
3.1.4 Ätiologie
3.1.5 Diagnostik
3.2 Asperger-Syndrom
3.2.1 Diagnosekriterien nach ICD-10 und DSM-IV
3.2.2 Epidemiologie
3.2.3 Symptomatik
3.2.4 Ätiologie
3.2.5 Diagostik
4 Soziale Probleme von autistischen Kindern
5 Interventionsmöglichkeiten: Sozialkompetenztraining mit Hilfe des TEACCH-Programms
6 Unterschiede zwischen dem frühkindlichen Autismus und dem Aspgerger-Syndrom
7 Zusammenfassung
Quellenverzeichnis