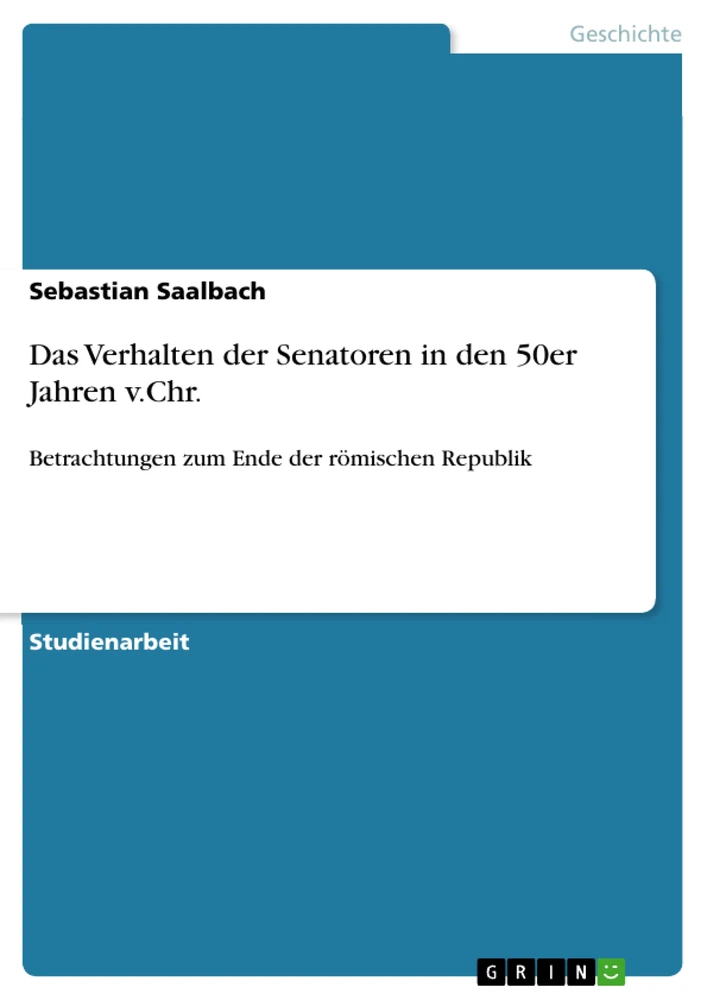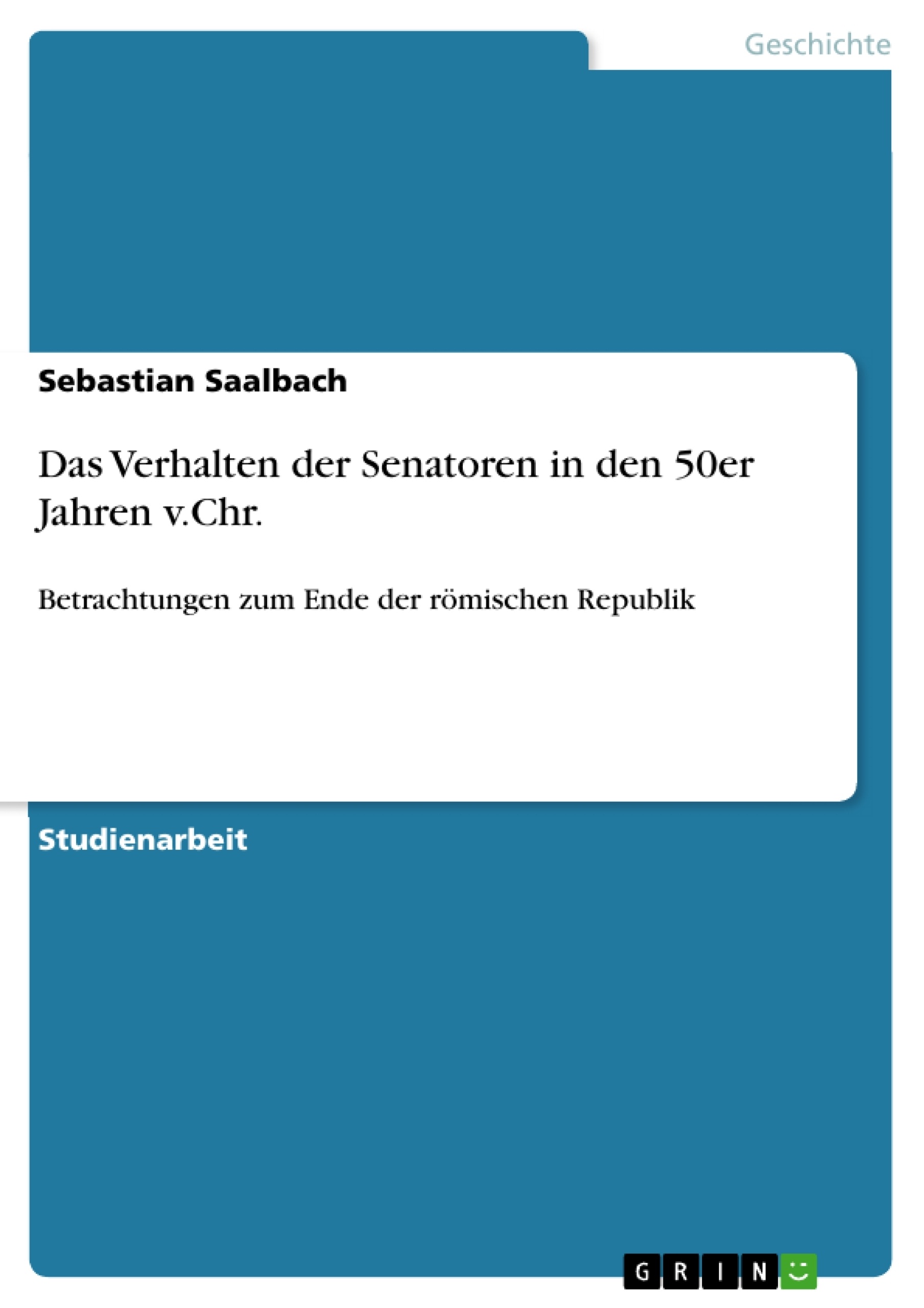Die fünfziger Jahre v. Chr. stellen einen Zeitraum der Krise in Rom dar, an deren Ende die traditionelle Staatsordnung im Bürgerkrieg verschwindet. Die aristokratisch beherrschte römische Republik geht unter. Die fünfziger Jahre sind besonders interessant, da an ihrem Anfang die senatorische Herrschaft in Rom als noch sehr gefestigt anzusehen ist, zehn Jahren später allerdings kommt es zum Bürgerkrieg zwischen Caesar und den Verteidigern der alten Ordnung. Caesar geht siegreich aus diesem Krieg hervor und verändert die staatliche Ordnung maßgeblich. Aus der Herrschaft einer Oberschicht ist die Alleinherrschaft von einem ihrer Abkömmlinge entstanden. Das Anliegen der vorliegenden Arbeit soll es sein, das Verhalten der Senatoren in besagtem Zeitraum zu untersuchen. Es wird sich hierbei auf diejenigen Senatoren konzentriert, die für eine starke Senatspartei eintreten, Vertreter der überkommenen Ordnung, die Partei der Optimaten. In chronologischer Reihenfolge sollen die Aktionen ihrer politischen Gegner betrachtet werden sowie die Reaktionen der Senatoren. Die Frage stellt sich, welche Möglichkeiten hatten die Senatoren überhaupt, um auf die Bedrohung ihrer Herrschaft reagieren zu können? Welche Maßnahmen haben sie dann tatsächlich ergriffen? Hatten diese Maßnahmen den gewünschten Erfolg? Da bekanntermaßen der Bürgerkrieg am Ende dieses Jahrzehnts steht, soll geklärt werden, warum offensichtlich die senatorische Politik gescheitert ist. Welchen Einfluß hatte der senatorische
Beitrag zu den innenpolitischen Ereignissen? Wie trugen ihre Maßnahmen zur Radikalisierung des politischen Kampfes mit ihren Gegnern bei und damit zur Destabilisierung der Republik? Mit welchen politischen Mitteln wurde Politik gemacht und verhindert? Wer waren die bedeutendsten Vertreter, die sich gegen Caesar und das Triumvirat stellten? Diesen Fragen soll im Folgenden nachgegangen werden.
Inhalt
Einleitung
1. Anfang
2. Der Senat
3. Das Triumvirat
4. Caesars Konsulat
5. Caesars Statthalterschaft
6. Nach der Konferenz von Luca
7. Der Antrag Caesar den Germanen auszuliefern
8. Das Jahr 54. Eine Chance für die Opposition?
9. Das Ende des Dreibundes
10. Das Jahr 51
11. Bis zum Ausbruch des
Bürgerkrieges
Ergebnisse
Literaturverzeichnis
Quellenverzeichnis