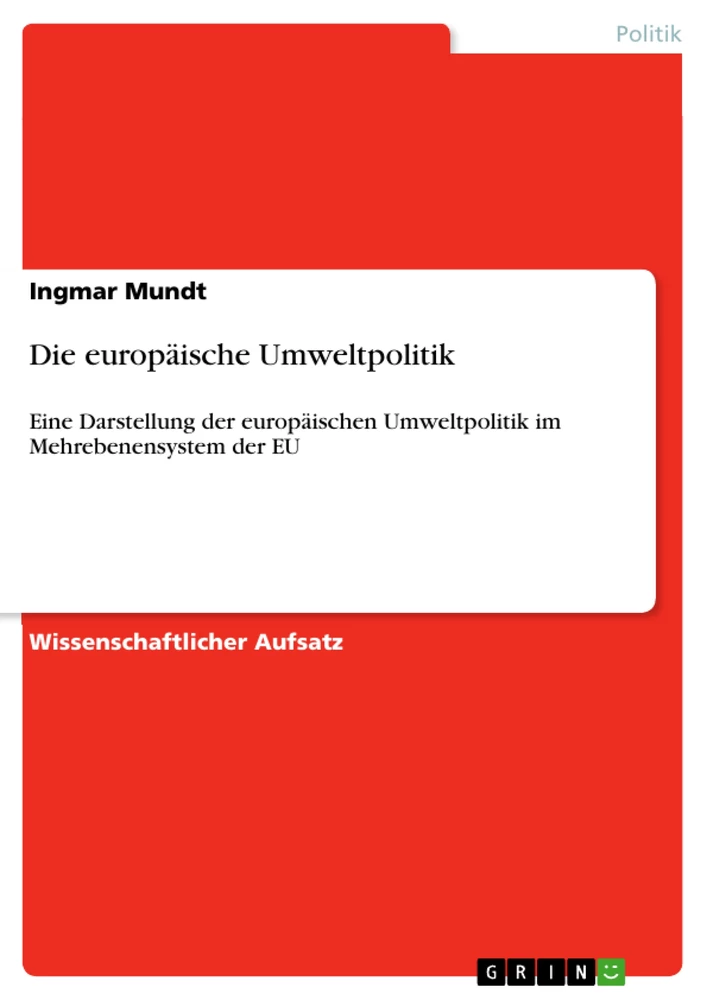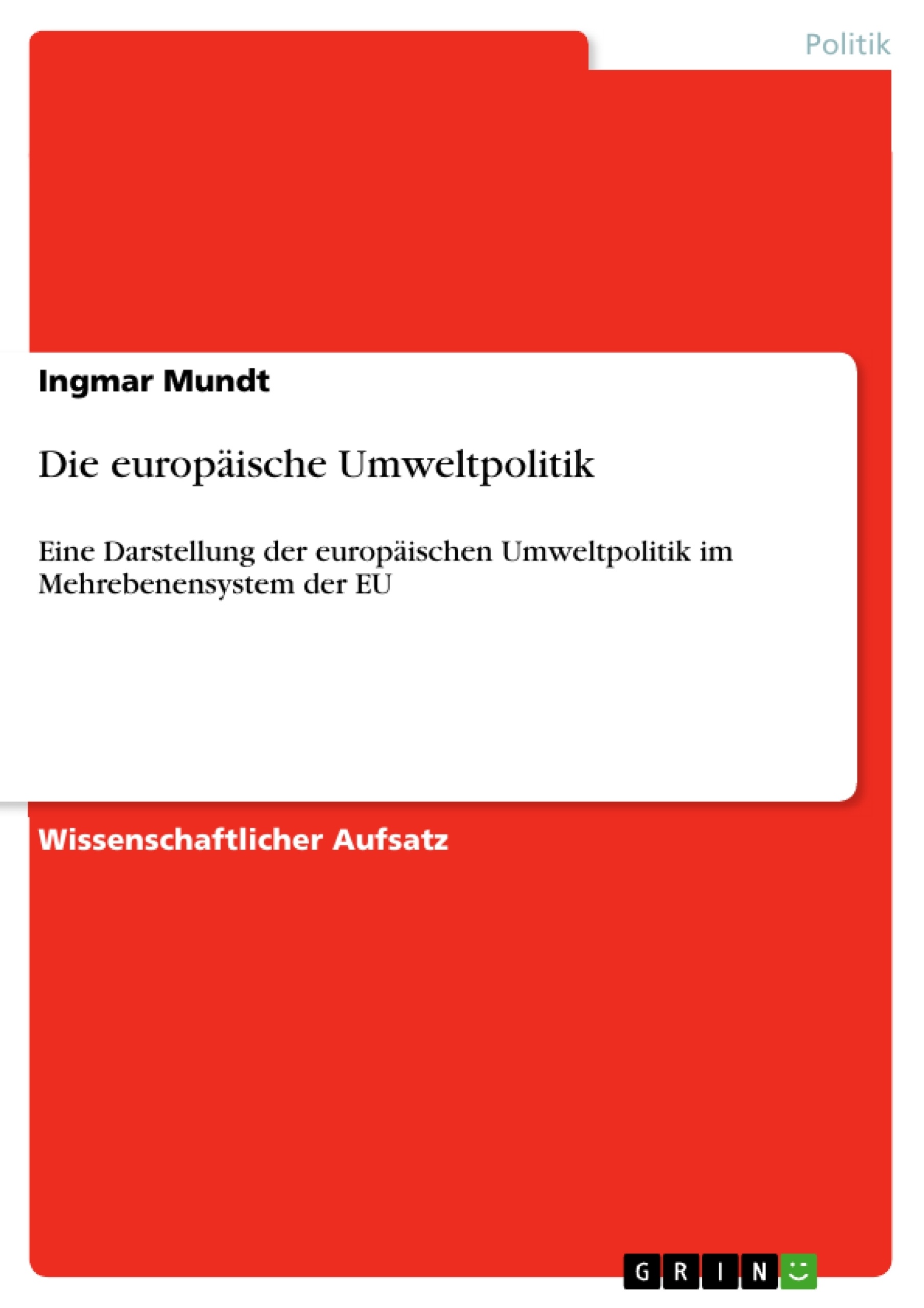Der anthropogene Klimawandel stellt die gesamte Menschheit vor eine schier unlösbare Aufgabe, fordert er doch eine noch nie dagewesene internationale Zusammenarbeit. Auf diversen Klimaschutzkonferenzen (Kioto, Kopenhagen) wird immer wieder die Notwendigkeit eines gemeinsamen Vorgehens beschworen, das Ergebnis bleibt meistens hinter den Erwartungen zurück. An vorderster Front dabei ist auch die Europäische Union, der vielleicht bedeutendste Staatenbund der Menschheitsgeschichte. Sie proklamiert für sich eine Vorreiterrolle in der Klimadiskussion einzunehmen und mit gutem Beispiel voranzugehen. Dabei ist eine Einigung innerhalb der Union oftmals sehr viel schwieriger und von langen Verhandlungen gekennzeichnet. Der EU kommt dabei in einem vertikalen Mehrebenensystem eine Doppelrolle zu: innerhalb der Union werden Richtlinien entwickelt die von den Nationalstaaten umgesetzt wird. Außerdem entwickeln die Mitgliedsstaaten einen gemeinsamen Standpunkt mit dem die EU auf internationalen Verhandlungen auftritt.
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
1. Einleitung
2. Grundlagen der EU – Umweltpolitik
2.1 Entwicklung
2.2 Prinzipien und Ziele
3. Die EU – Umweltpolitik im Mehrebenensystem
3.1 Die Globale Ebene
3.2 Die europäische Ebene
3.2.1 Institutionen der europäischen Umweltpolitik
3.2.2 Die europäische Umweltpolitik als integrative Kraft
3.3 Die Nationale Ebene
3.4 Die persönliche Ebene
4. Fazit
5. Literatur – und Quellenverzeichnis