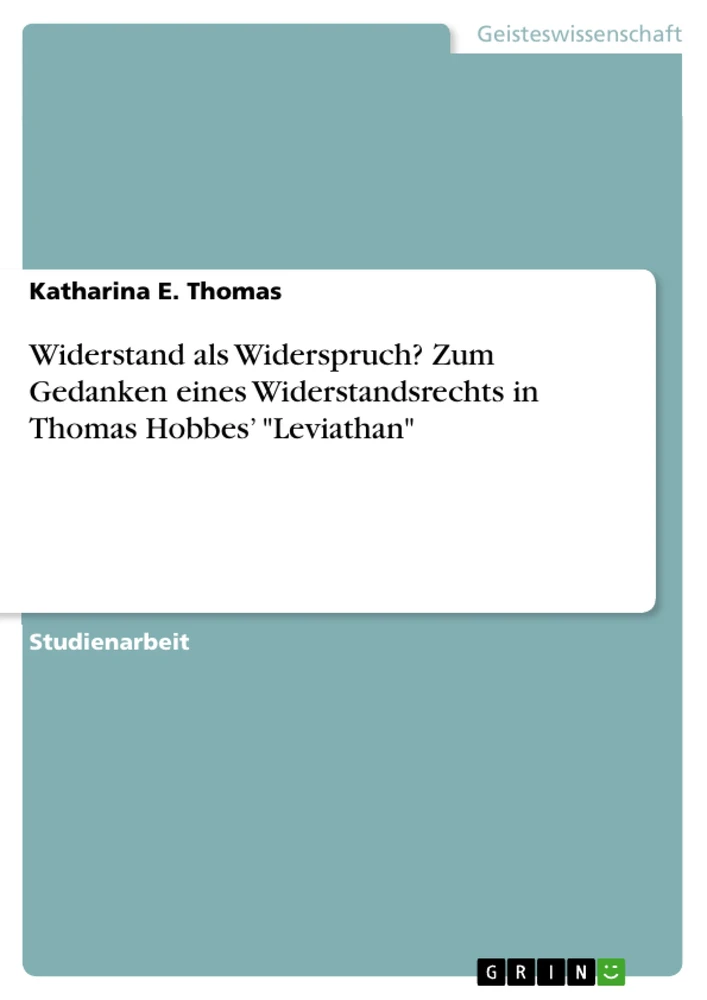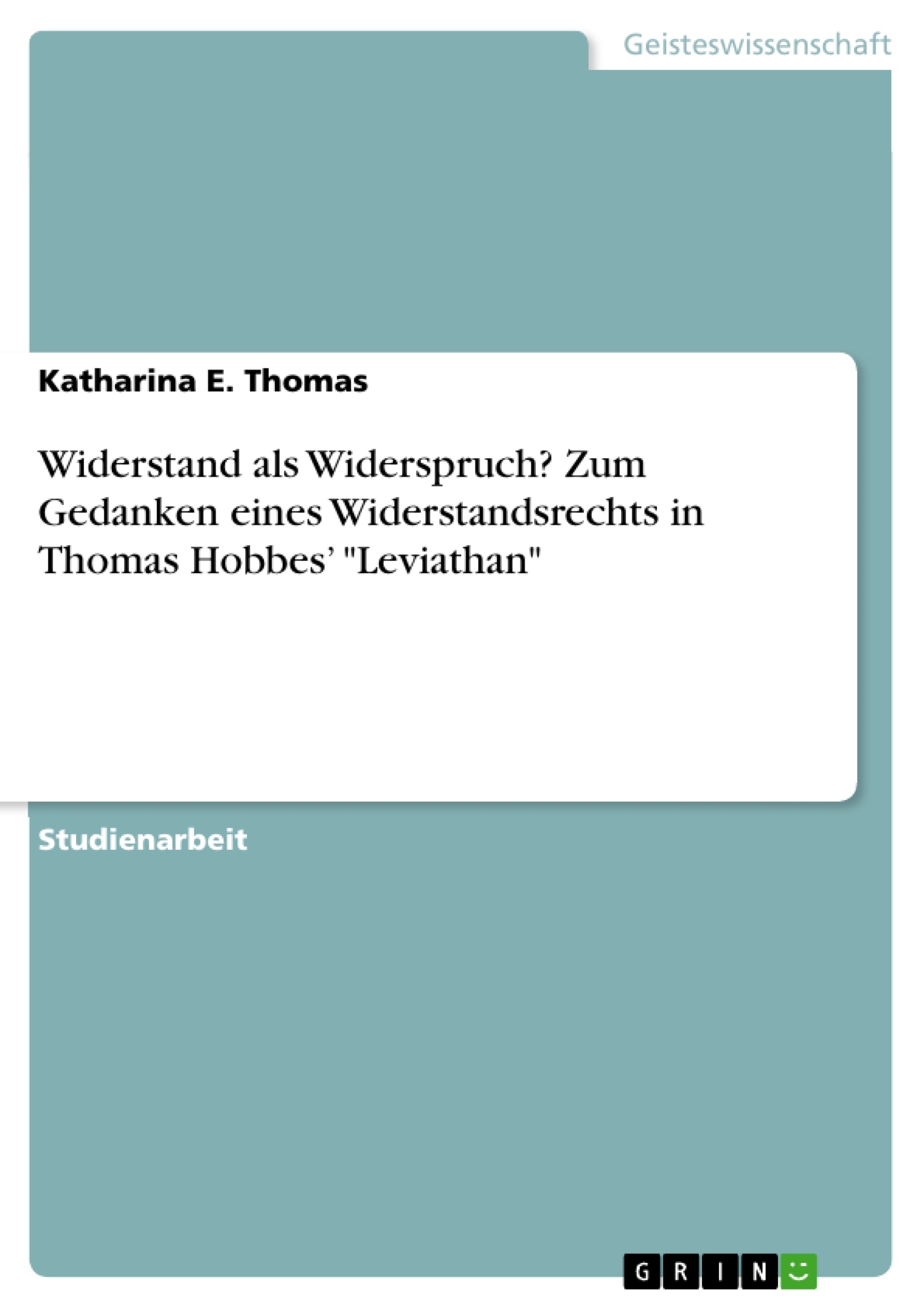Der Leviathan – dieses Werk des englischen Philosophen Thomas Hobbes beschäftigt die Wissenschaft noch immer. Die Fragen, die es zu beantworten sucht und auch die Fragen, die es aufwirft, sind immer noch aktuell. Die Frage, die der Leviathan beantworten will, ist diejenige nach der politischen Struktur, die für ein friedliches Zusammenleben der Menschen unerläßlich ist. Für Thomas Hobbes entsteht diese aus der Unterwerfung der Menschen unter einen absoluten Souverän, um dem Naturzustand des Kriegs aller gegen alle zu entgehen.
Eine der Fragen, die der Leviathan dagegen aufwirft, ist die nach einem möglichen Recht auf Widerstand gegen diesen absoluten Souverän. Selbst wenn man voraussetzte, daß Hobbes generell ein Selbstverteidigungsrecht einräumt, da der Mensch seinen Selbsterhaltungstrieb schlechthin nicht unterdrücken kann und sich zur Wehr setzen muß, wenn er – und sei es von seiten des von ihm eingesetzten Herrschers – bedroht wird, scheint der Leviathan dieses Recht nicht näher zu präzisieren. Wie verhält es sich beispielsweise mit dem Hobbes’schen absoluten Herrscher? Ist er tatsächlich so absolut, wie es vordergründig scheint?
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Das Verhältnis zwischen Souverän und Untertan im Leviathan
2.1 Rechtsverzicht und Autorisierung des Souveräns
2.2 Das Verhältnis von Souverän und Untertanen
3. Widerstandsrecht im Leviathan
3.1 Das Selbstverteidigungsrecht
3.2 Grenzen des Widerstandes
4. Schlußbemerkung: Implikationen für Hobbes’ politische Philosophie
5. Quellen