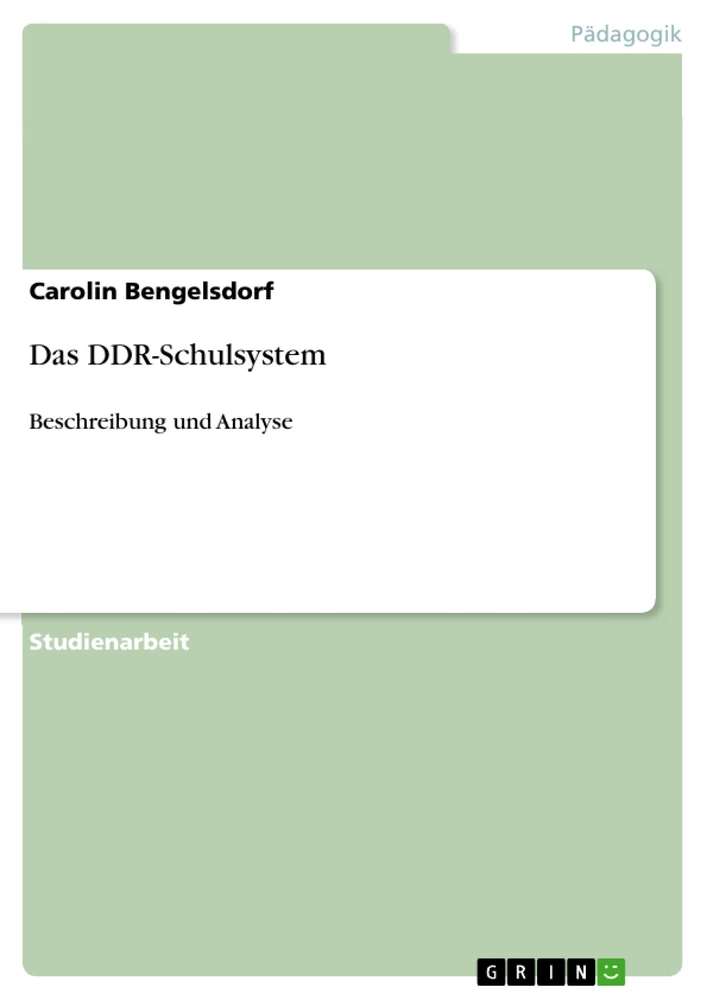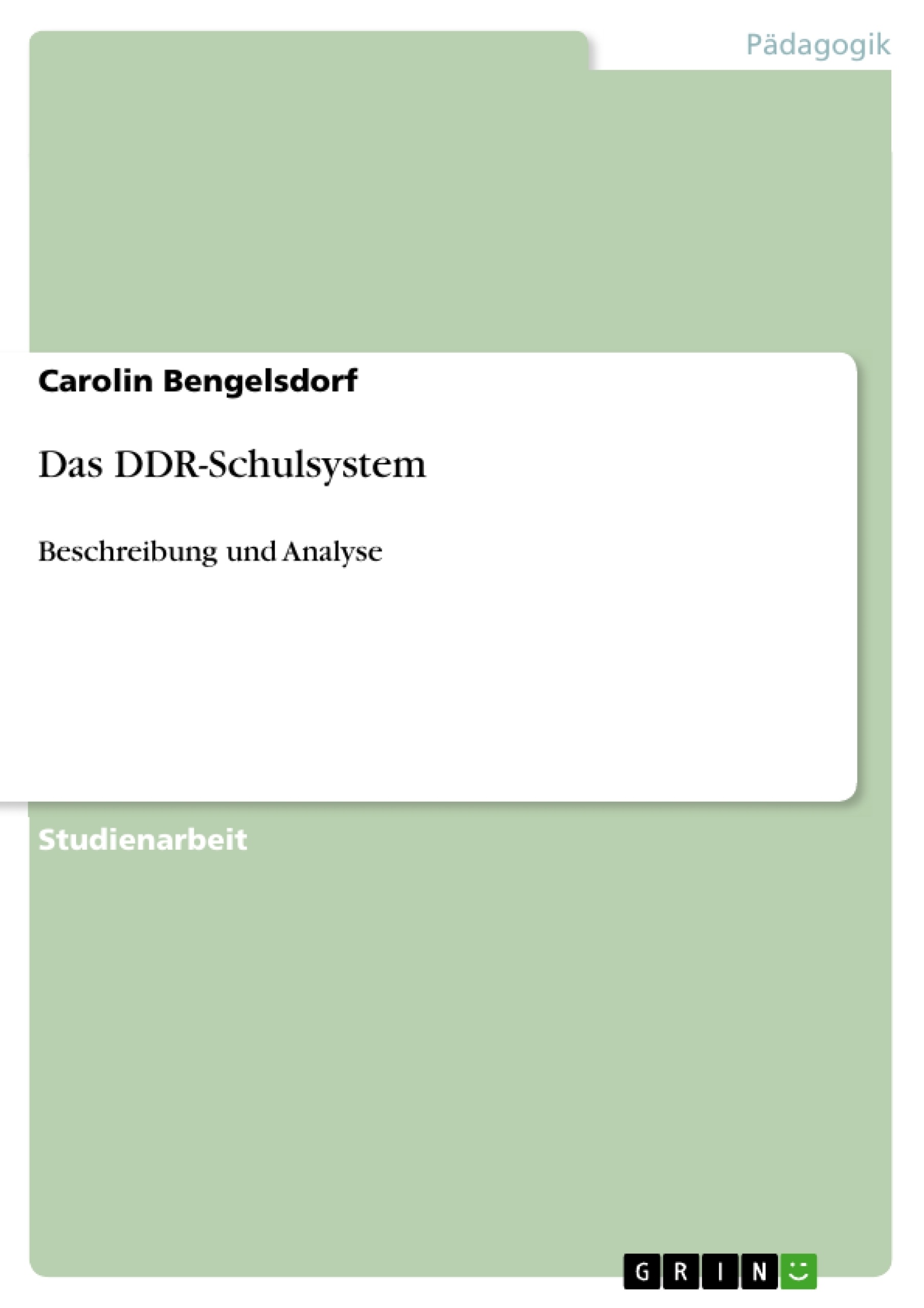Die „allseitig entwickelte sozialistische Persönlichkeit“ war das Ziel der Bildungspolitik der
Deutschen Demokratischen Republik (DDR). Das sozialistische Bildungssystem wollte gute
Staatsbürger erziehen, die sich mit ihrem Land und der Staatsform, dem Sozialismus identifizieren.
Als diese geformten „sozialistischen Persönlichkeiten“ im Herbst 1989 in Leipzig auf die Straße
gingen und die ersten Montagsdemonstrationen aus Protest gegen die politischen Verhältnisse
organisierten, war dies mit ein erster Meilenstein für die deutsche Wiedervereinigung am 3. Oktober
1990, dem Beitritt der DDR zur Bundesrepublik Deutschland.Die DDR ist seit diesem Tag Geschichte
und somit auch das Bildungssystem dieses Landes, das sich 1946 strukturierte, sich über mehr als 40
Jahre erstreckte und sich in dieser Zeit auch mehrmals reformierte. Ein wichtiges Element des im
Umbruch begriffenen Schulwesens waren die Neulehrer in der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ).
Das DDR Bildungssystem begann mit den Kinderkrippen und den Kindergärten, worauf dann die
zehnklassige allgemein bildende polytechnische Oberschule (POS) folgte. Aufbauend auf die POS
folgten die erweiterte Oberschule (EOS), verschiedene Spezialschulen, Fachschulen, Hochschulen und
Universitäten (vgl. Günther/Uhlig 1969, S. 132/133). Ein bezeichnender Bestandteil des Schulsystems
der DDR war die Pionierorganisation und die darauf aufbauende Jugendorganisation der Freien
Deutschen Jugend (FDJ). Beides waren Massenorganisationen, die mit der Bildungspolitik der DDR
im engen Zusammenhang stehen. Ein interessanter und sehr wichtiger Aspekt sind die Auswirkungen
der in der DDR angewandten Schulpolitik, weil die Jahre als Kind und Jugendlicher und die
empfangende Bildung und Erziehung einen Menschen besonders bedeutend und nachhaltig prägt. Hier
spielt neben Aufbau und Struktur des Schulsystems der DDR die angewandte politisch-ideologische
Erziehung eine nicht unwesentliche Rolle. Gibt es Positives oder Übertragbares, was man dem
Bildungswesen der DDR entnehmen kann ohne sich von der aufkommenden umgangssprachlichen
„Ostalgie-Welle“ beeinflussen zu lassen?
Inhaltsverzeichnis:
1. Einleitung
2. Die Deutsche Demokratische Republik
3. Der Beginn des Schulsystems in der sowjetischen Besatzungszone
3.1.Die Neulehrer in der SBZ
3.2.Trennung von Schule und Kirche
4. Das Schulsystem von 1949 - 1956
5. Die Struktur des Bildungssystems der DDR
5.1. Kindergrippe
5.2. Kindergarten
5.3. Polytechnische Oberschule
5.4. Erweiterte Oberschule
5.5. Berufsausbildung
5.6. Fachschulen
5.7. Universität und Hochschule
5.8. Spezialschule und Spezialklasse
5.9. Sonderschule
6. Politisch-ideologische Erziehung
6.1. Pionierorganisation „Ernst Thälmann"
6.2. Freie Deutsche Jugend
7. Rückblick auf das DDR-Schulsystem
7.1. Positive Elemente
7.2. Negative Elemente
8. Schlussbetrachtung