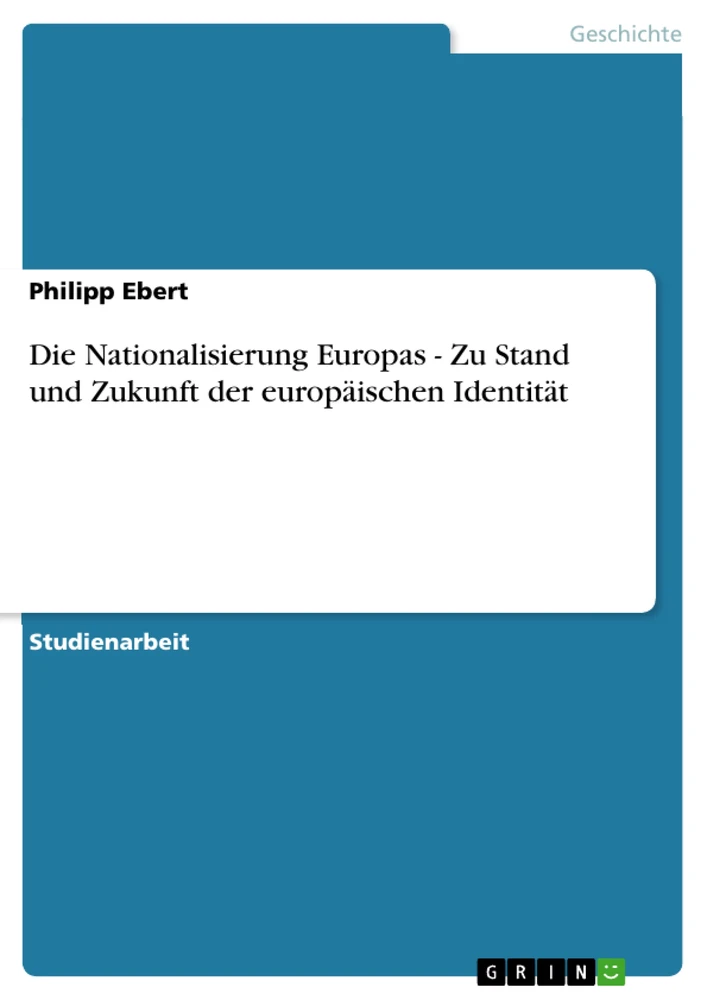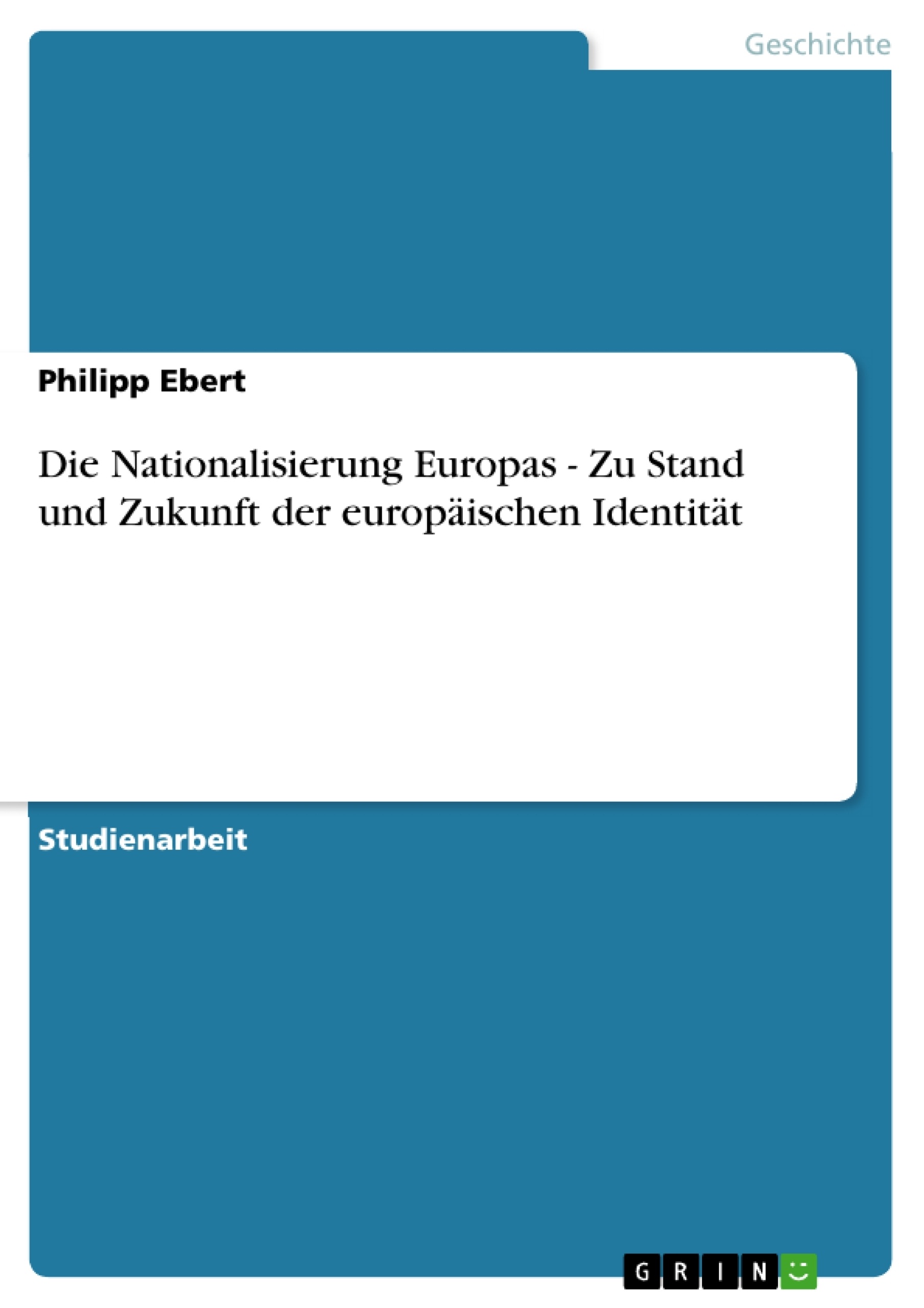Diese Arbeit geht daher der Frage nach, ob man die aktuelle Form der kollektiven europäischen Identität als Nation bezeichnen kann und welche Perspektiven sich für das Nation-Sein von Europa zeichnen lassen. Die Europäer, so postuliere ich, sind zur Zeit noch nicht als Nation zu verstehen –diese Nation ist allerdings im Werden begriffen. Dieser These gilt es im Laufe der Arbeit nachzugehen.
Um über ein politisch so wirkmächtiges Phänomen wie Nation diskutieren zu können, ist es unerlässlich, Begrifflichkeiten zu klären. Nation soll hier in Anlehnung an Anderson verstanden werden als „(…) vorgestellte politische Gemeinschaft –vorgestellt als begrenzt und souverän.“
Die konstruktivistische Nationalismusforschung hat zwei Bedingungen formuliert, die obligatorisch sind, damit eine Gruppe eine Nation sein kann: erstens die Angehörigkeit zu einer gemeinsamen Kultur, von Gellner definiert als „ (...) a system of ideas and signs and associations and ways of behaving and communicating.“ Zweitens ist unerlässlich, dass sich die Mitglieder einer Gruppe gegenseitig als Angehörige der gleichen Nation sehen oder begreifen. „(...) nations are the artefacts of men‘s convictions and loyalities and solidarities.“
In einer Betrachtung der etwaigen Nation Europa gilt es zu untersuchen, ob die Angehörigen der EU-Staaten einer gemeinsamen Kultur angehören und ob sie sich gegenseitig als Nation verstehen. Die theoretische, aber auch die empirische Beschäftigung mit dem Phänomen Identität hat indes gezeigt, dass es zur Bildung einer Identität immer ein „konstitutiv[es] Außerhalb“ braucht, dass Identität also nur durch Alterität entstehen kann. Es ist daher auch zu untersuchen, was ein solches konstitutives Außerhalb für die europäische Identität ist oder perspektivisch sein könnte –denn ohne ein solches wird es eine europäische Nation nicht geben.
Nach einem Kapitel mit Definitionen und Annäherungen an zentrale Begrifflichkeiten will ich untersuchen, welche kulturellen Gemeinsamkeiten zur Imagination einer europäischen Identität taugen und welche Relevanz sie besitzen. Anschließend werde ich mich v.a. anhand von Daten von Eurostat mit der Frage der gegenseitigen Anerkennung als Nation beschäftigen. Daran knüpft an die Diskussion des konstitutiven Außerhalb „der Europäer“. Hier sollen auch mögliche Differenzbildungsprozesse benannt werden, abschließend Schlüsse aus der Untersuchung zu ziehen und einen Ausblick zu wagen.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Annäherungen und Definitionen: Kollektive Identität, Kollektive Erinnerung und Nationalisierung
3. Eine Europäische Kultur?
3.1. „Die Sprache lädt zur Vereinigung ein“ - Nation Europa und die Sprache "
3.2. Historischer Diskurs und Imagination von Europa"
3.3. Europäische Kultur, Europäische Werte"
4. Wir sind wir - die gegenseitige Anerkennung als Nation
5. Das Konstitutive Außerhalb
6. Fazit und Ausblick
7. Literaturverzeichnis