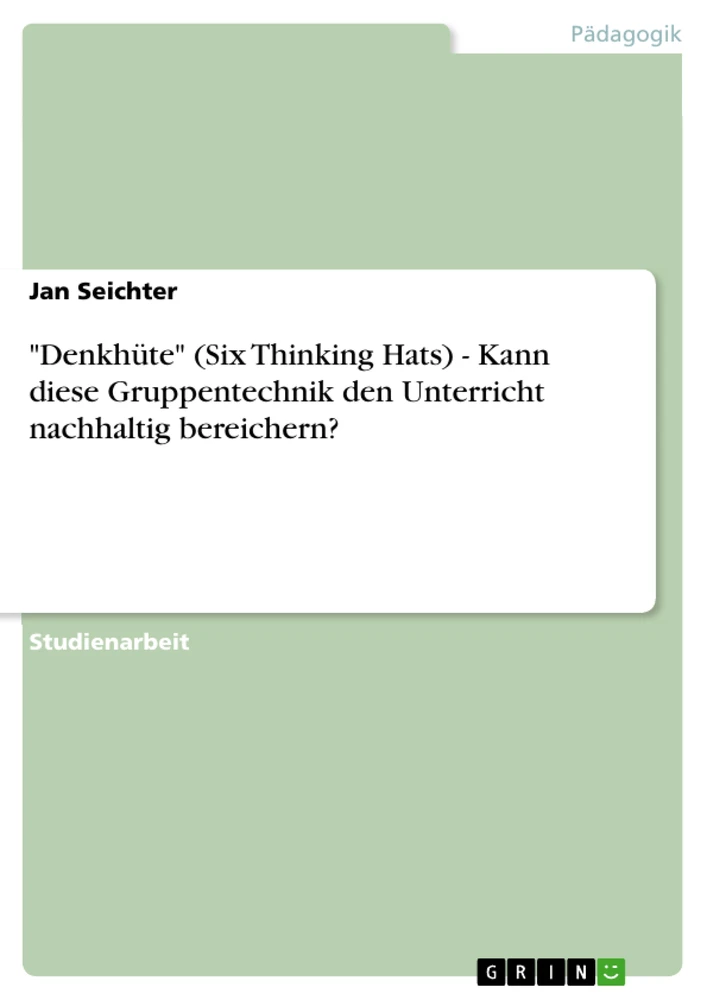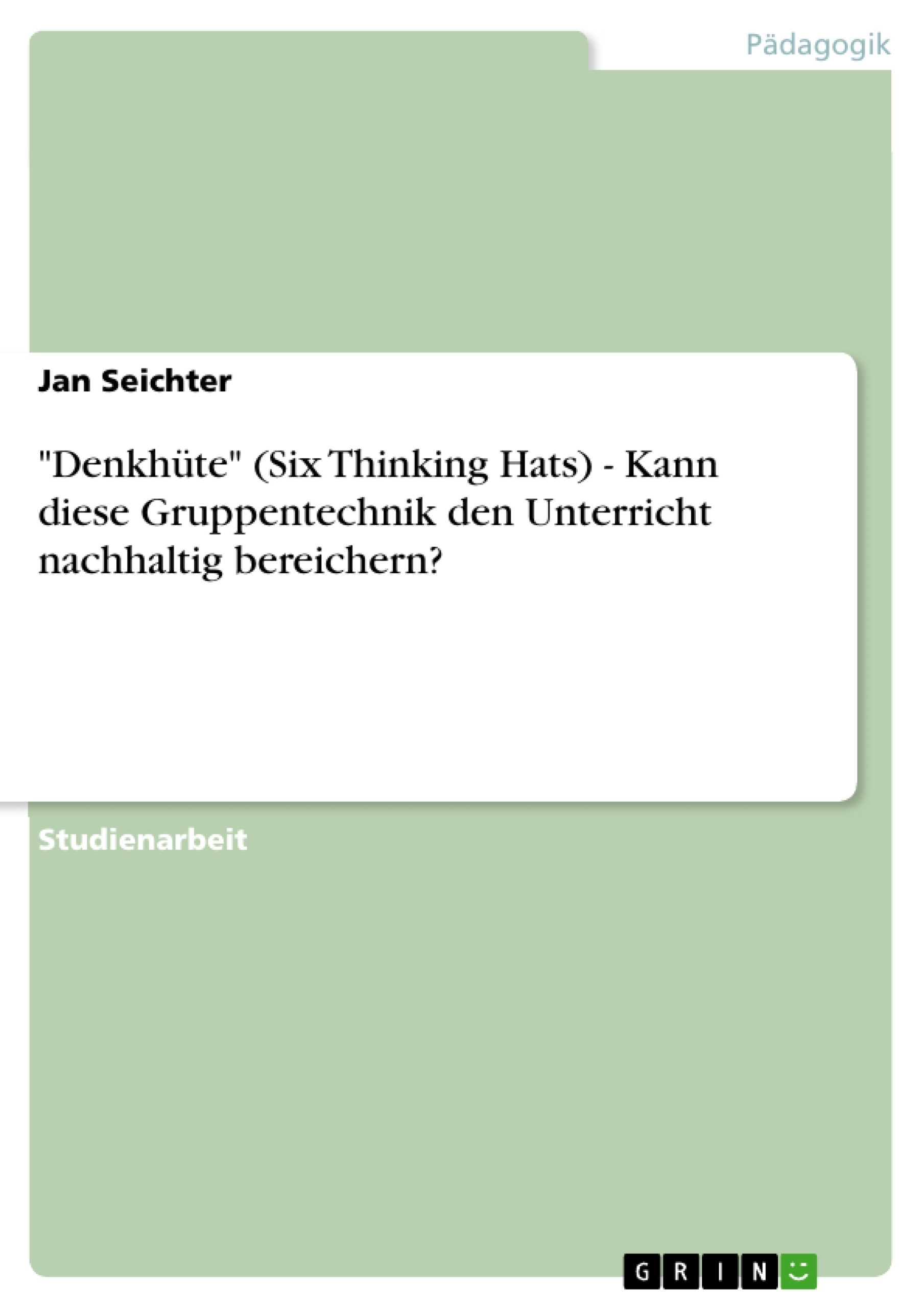Dies ist eine Form des Lernens in Gruppen und eine exzellente Methode, ein Unterrichtsproblem oder eine Thematik zu bearbeiten und abzuschließen. Diese Lerntechnik findet sich im Umfeld von vielen Spielen, Methoden und Arbeitstechniken, die in zahlreichen Büchern beschrieben und ausgeleuchtet wurden. Erstaunlicher Weise findet man die Gruppenmethodik der „Denkhüte“, oder auch „Six Thinking Hats“, in kaum einem Buch verzeichnet. Dieses Thema schien bei meiner Literaturrecherche beinahe unausgeleuchtet. Lediglich in einem Buch von Matthias Nöllke konnte ich etwas Genaueres über diese Technik lesen. Eine Tatsache, die ich als Fehler ansehe. Diese Methode eignet sich in vielerlei Hinsicht zum Vertiefen eines Themas, zur Ausweitung einer Thematik auf andere und zum Abschluss einer Problematik. Dies unbeobachtet zu lassen, heißt in diesem Fall, eine Fackel zu besitzen, welche einen Raum ausleuchten kann, sich aber zu weigern die Fackel anzuzünden. Entweder, weil man zu unsicher ist und unbedingt auf die neuste Technik der Taschenlampen warten will oder weil man sich weigert das Feuer als Erfindung anzuerkennen. So oder so verbirgt sich hier ungeahntes Potential, dass ich, da es in der Literatur und anderen Bereichen offensichtlich bisher zu mangelhaft betrachtet wurde, im Zuge dieser Arbeit näher veranschaulichen möchte. Zu Beginn wird eine detailliertere Betrachtung der didaktischen Variante „In Gruppen lernen“ vorgenommen, welche auf die spezifische Methode der „Denkhüte“ hinleitet. Dort soll eine genaue Einordnung in verschiedenen Gebieten, wie die Art der Methode und den Grad ihrer Mehrpoligkeit , vorgenommen werden, sowie ein genauer Bezug zu Sanders didaktischen Prinzipien. Auf diese Weise soll aufgezeigt werden, wie innovativ das Konzept der „Denkhüte“ ist, da es auch die üblichen Probleme des Lernens in Gruppen umgehen kann. Dies soll in dem Versuch gipfeln, ein zusätzliches Konzept darzustellen, welches die einzige immer wieder auftauchende Schwäche der „Denkhüte“ beseitigen soll, nämlich dass sie nicht zum Einstieg in ein Thema geeignet sind, da essentielles Vorwissen für die Anwendung von Nöten ist. Mit anderen Worten eine Erweiterung, die bewirken soll, dass man die Denkhüte auch zum Lernen eines neuen Themas einsetzen kann.
Gliederung
1. Einleitung
2. „In Gruppen lernen“
3. Analyse des Modells „Denkhüte“
3.1. Eine eigene Einordnung
3.2. Bezug auf Sanders didaktische Prinzipien
3.3. Die Ausweitung des Modells auf die Erlernung eines neuen Themas
4. Fazit
5. Literaturverzeichnis
6. Anhang