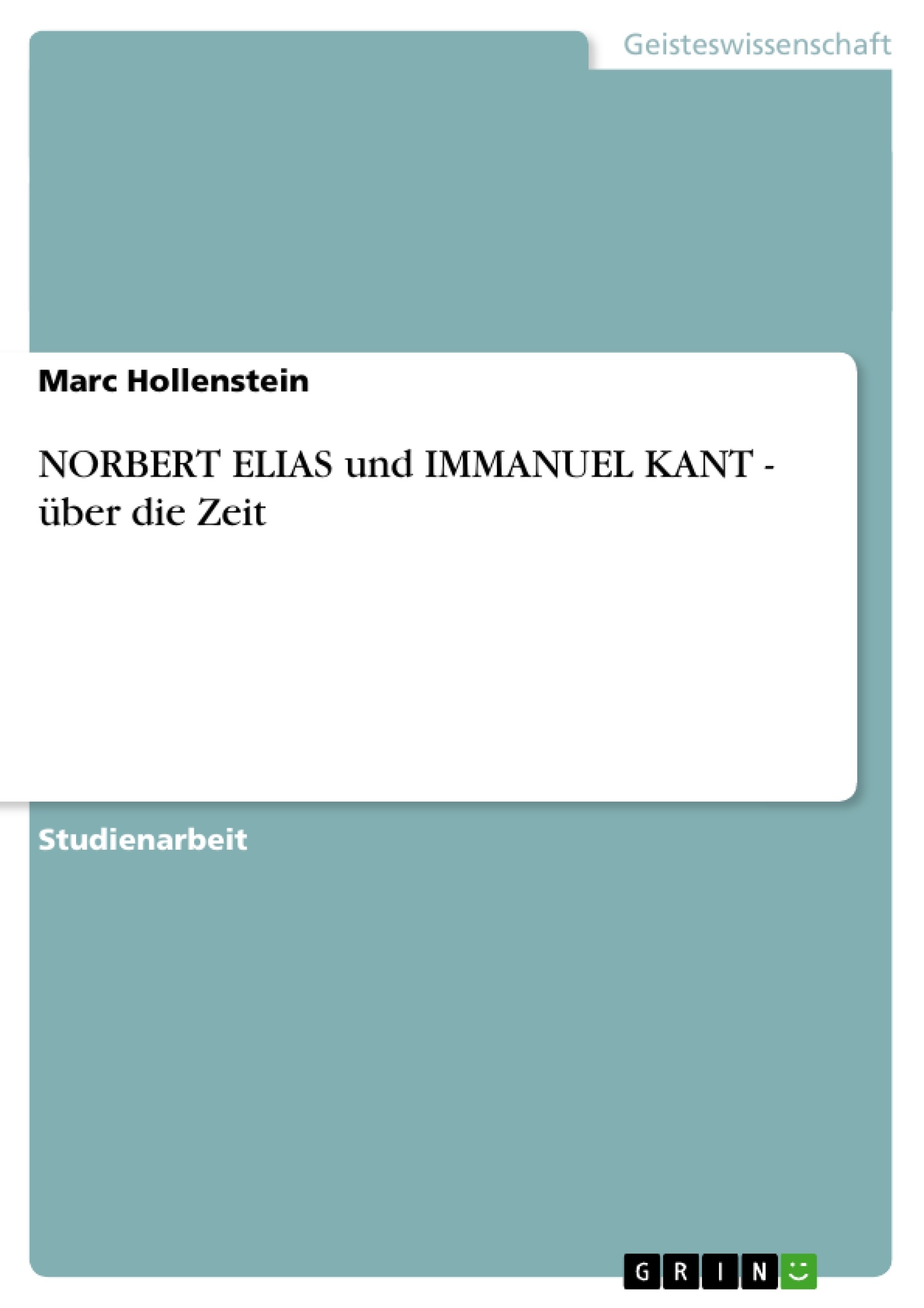Mein Anliegen ist es nicht, die Philosophie Kants darzulegen, sondern bloß auf seine Aussagen über die Zeit näher einzugehen, um erstens klarzustellen, daß die beiden entgegengesetzten Erkenntnistheorien wie sie Elias kurz skizziert hat, durch Kant sowieso schon gelöst oder vereint worden sind (und nicht durch Elias‘ Theorie des menschlichen Wissens), um zweitens Kants Zeitbegriff darzulegen und um drittens die abstruse Ansicht eines fünfdimensionalen Universums, wie sie von Elias beschrieben wurde, zu widerlegen.
Durch die Lektüre des Empiristen Humes wurde Kant damals aus seinem dogmatischen Schlummer geweckt. Er sah ein, daß sowohl der Rationalismus als auch der Empirismus gerechtfertigt waren. Vernunft allein konnte nicht zu Erkenntnis führen, und Erfahrung allein auch nicht. Sodann begann er die beiden entgegengesetzten Strebungen miteinander zu kombinieren.
Nach Kant können Zugleich und Aufeinanderfolge nicht wahrgenommen werden, wenn die Vorstellung der Zeit nicht schon gegeben wäre. Das heißt, die Zeit ist eine notwendige Vorstellung, die allen Anschauungen zugrunde liegt. Sie ist a priori, in ihr allein ist alle Wirklichkeit der Erscheinungen möglich. Sie ist also die Bedingung der Möglichkeit der (aller) Erscheinungen. Sie ist die subjektive Bedingung, unter der alle Anschauungen in uns stattfinden können. Anzumerken ist hier, daß Kant zwischen noumenon (Ding an sich) und phaenomenon (Erscheinung) unterscheidet. Insofern zeigt sich die Zeit als Naturgegebenheit, als eine in der Natur des Menschen angelegte Vorstellung (vgl. Elias) mit der Erscheinungen zur Anschauung werden können.
NORBERT ELIAS und IMMANUEL KANT - über die Zeit
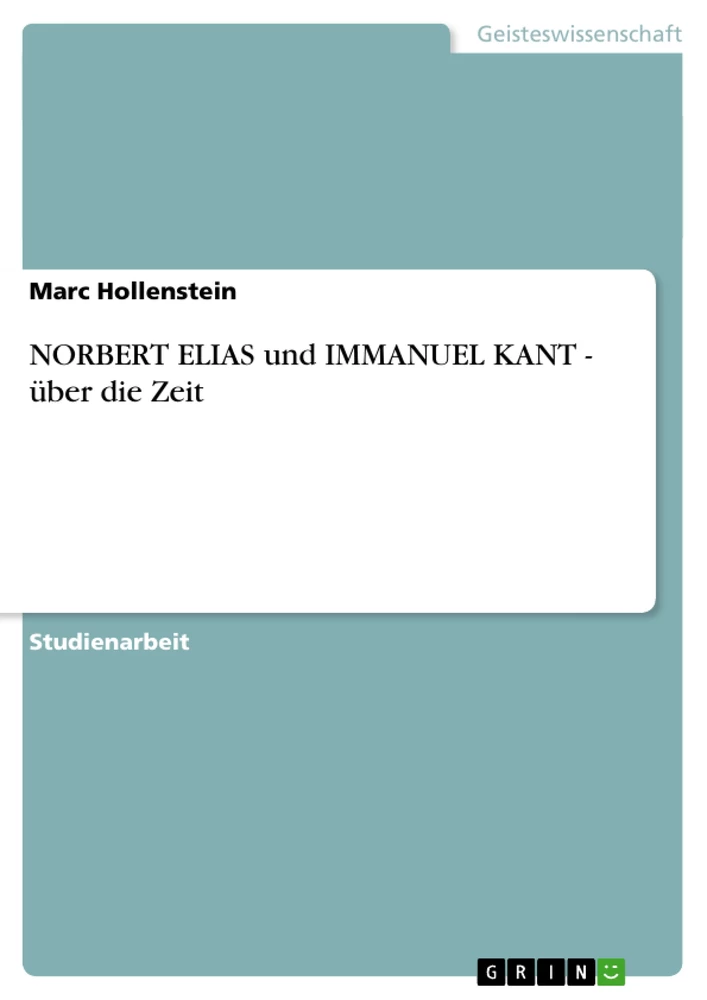
Seminararbeit , 2001 , 5 Seiten , Note: sehr gut
Autor:in: Mag. Marc Hollenstein (Autor:in)
Philosophie - Philosophie des 20. Jahrhunderts
Leseprobe & Details Blick ins Buch