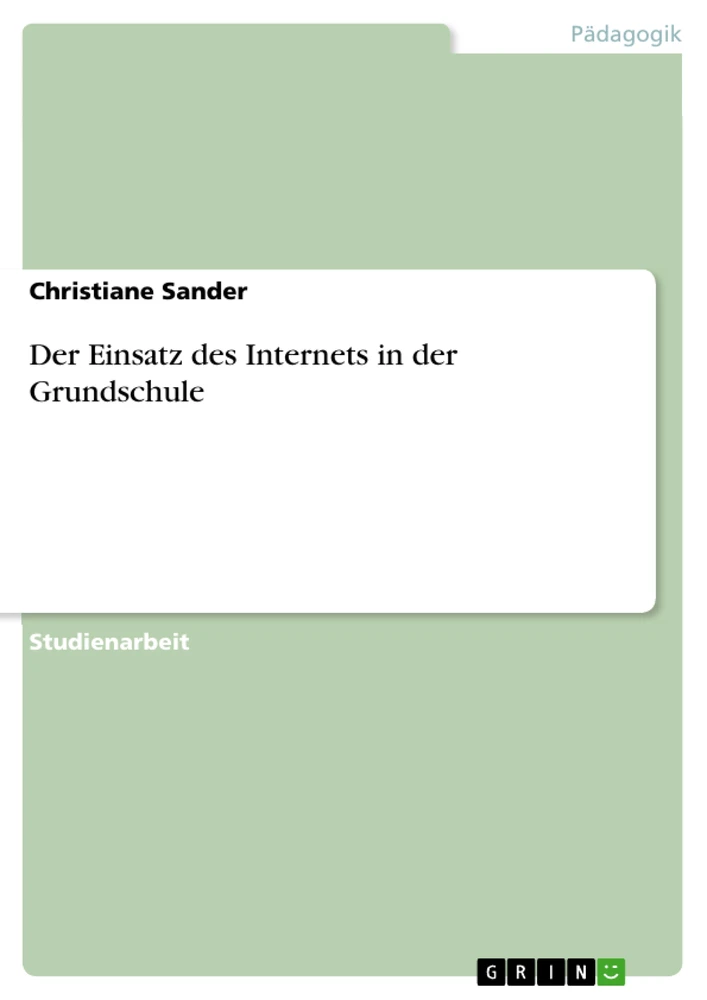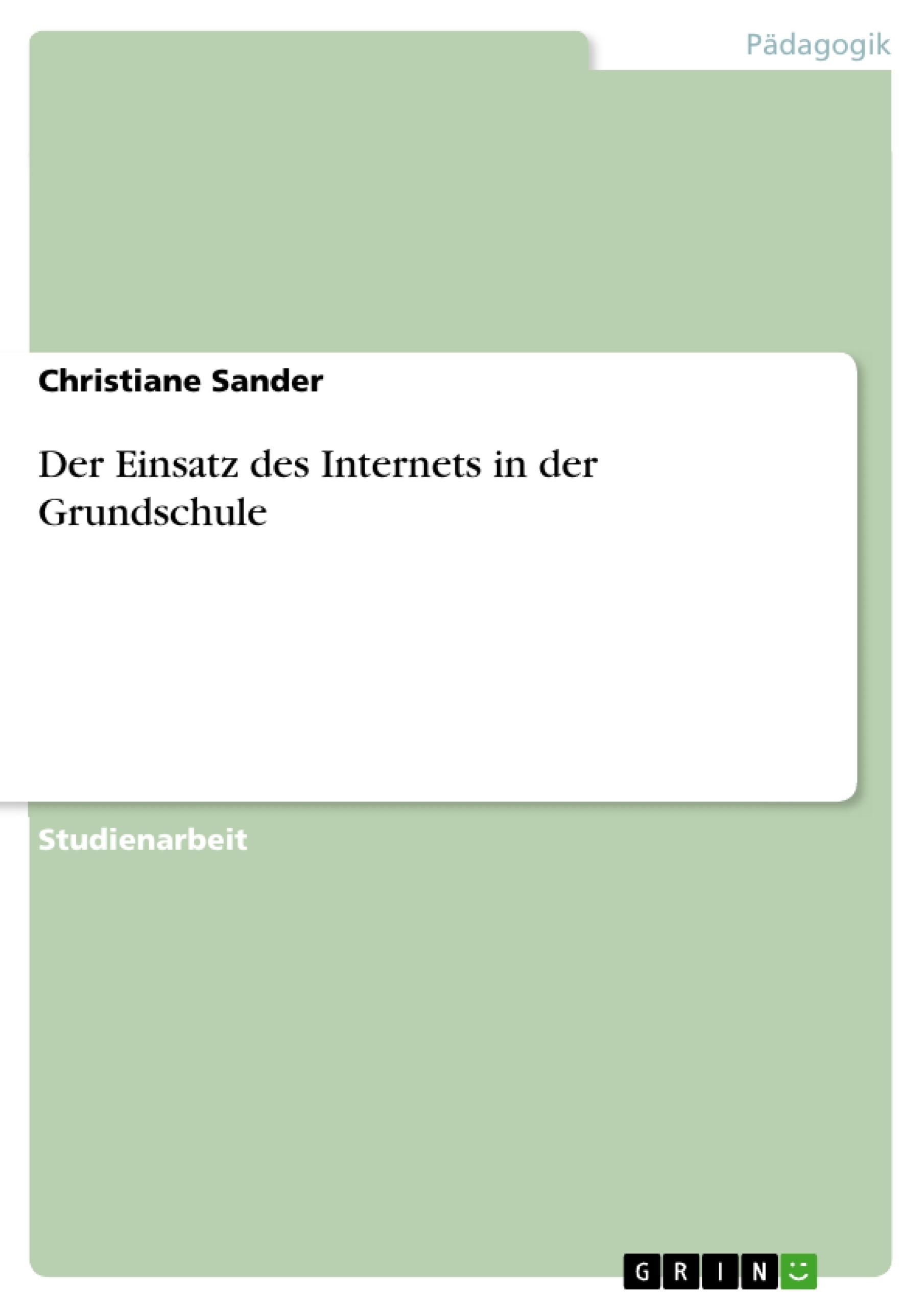Unsere Zeit ist von Medien geprägt. Sie beeinflussen und beanspruchen unser Denken, Erleben, Handeln und Kommunizieren. Unterschiedliche Medien werden miteinander verknüpft. Der Fokus der Medienarbeit sollte in den Schulen auf authentischen Anwendungsfeldern, Lernsituationen und realitätsnahen Lernaufgaben liegen und für den Lerner geordnete Lernziele definieren. Diese Lernaktivität wird nicht nur durch die objekthafte Eigenschaft des Multimedia-Systems, sondern durch die Interaktivität zwischen den Lernenden und dem Lernmaterial ausgeführt.
Die verbreitete Nutzung des Internets in allen gesellschaftlichen Bereichen stellt für die Schulen eine Herausforderung da. Das Erschließen neuer Lern-Umwelten und damit die Wissens- und Wirklichkeitskonstruktion ist ein Leitthema geworden. Die Angebote sind vielfältig z.B. Wissensspeicher, interaktive Lernplattformen; auch die TV-Sendungen haben Internetauftritte. Oft sind sie unübersichtlich und eine Auswahl zu setzen, erscheint schwer. So steht die Frage: Kann das Internet in der Grundschule zur Nutzung als Unterrichtsmittel gewinnbringend eingesetzt werden? Chancen und Grenzen des Einsatzes von Medien werden in dieser Arbeit aus medienpädagogischer Sicht betrachtet, um zu überprüfen, ob mit den vorhandenen und zu erwerbenden Kompetenzen das Internet mit seinen vielfältigen Informationen konstruktiv genutzt werden kann.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Unterricht in der Grundschule
2.1 Das Lernen aus konstruktivistischer Perspektive
2.2 Der konstruktivistische Lernprozess im Grundschulalter
2.2.1 Die konstruktivistische Lernumgebung
2.2.2 Grenzen des konstruktivistischen Lernansatzes
3 Medien
3.1 Was sind neue Medien?
3.2 Das Medium Internet als Werkzeug
3.3 Medienkompetenz als Voraussetzung
3.3.1 Medienkompetenz der Lehrer in der Grundschule
3.3.2 Medienkompetenz der Schüler in der Grundschule
3.4 Der Einsatz des Internets in der Grundschule
3.4.1 Technische Ausstattung der Grundschule
3.4.2 Grenzen des Internets im Schulalltag
4 Selbstständiges Lernen in der Grundschule
4.1 Lernen durch Nutzung des Internets als Unterrichtsmittel
4.2 Risiken bei der Nutzung des Internets
4.3 Grenzen des Internets aus konstruktivistischer Sicht
5 Fazit und Ausblick
6 Literaturverzeichnis