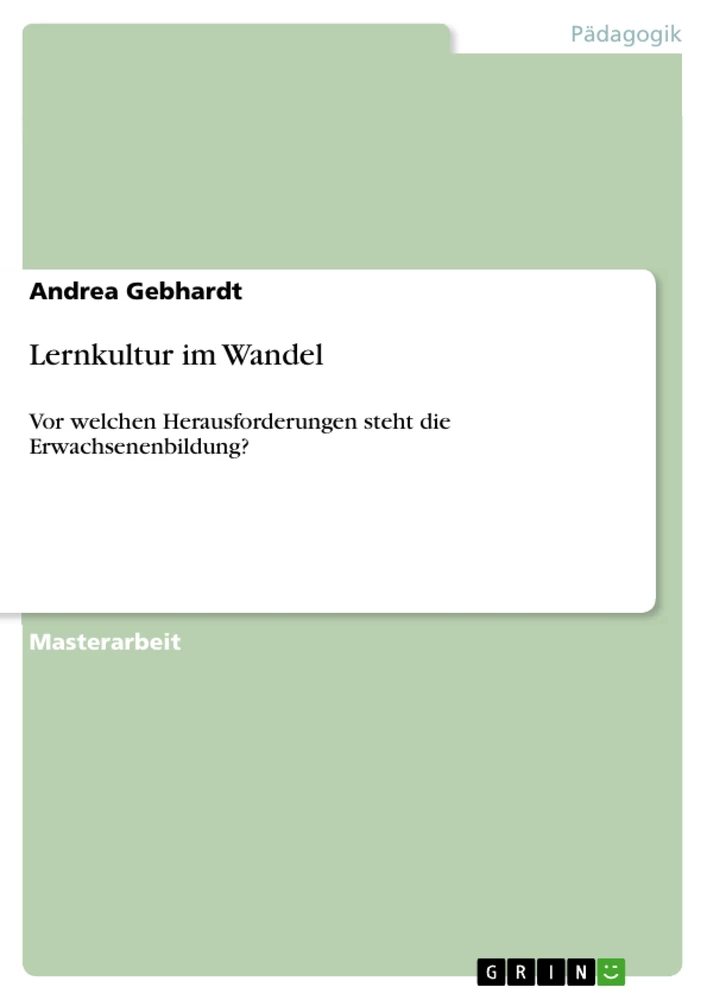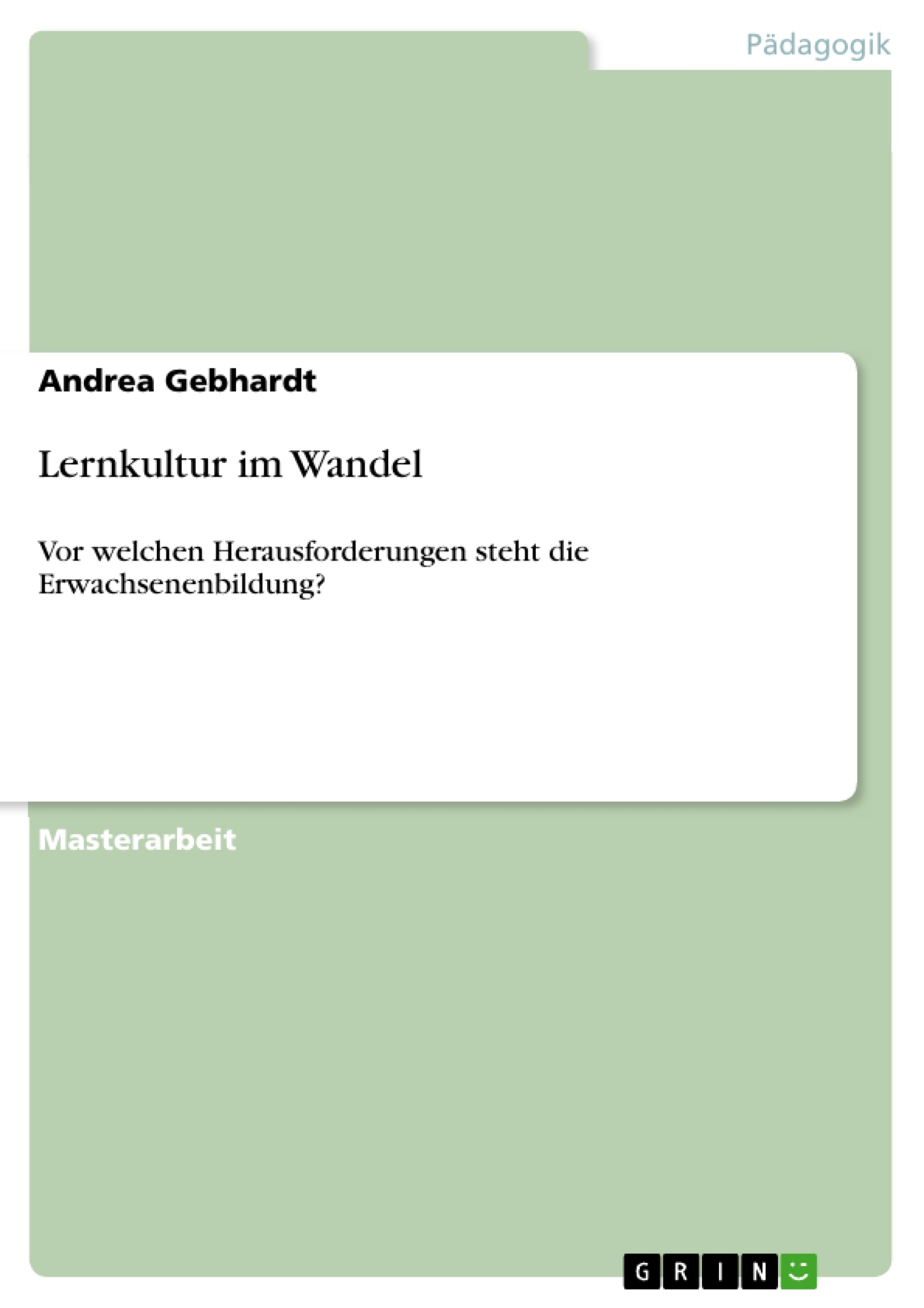„Erwachsene sind lernfähig,
aber nicht belehrbar“
(H. Siebert)
Mit dieser Erkenntnis bringt Horst Siebert den Kern des Lernkulturwandels auf den Punkt. Lernen wird nicht länger erzeugt, sondern es ist vielmehr die Aufgabe der Erwachsenenbildung, Lernsituationen derart zu gestalten, dass Lernen ermöglicht wird.
Die gesellschaftlichen Veränderungen der letzten Jahrzehnte haben in hohem Maße Einfluss auf den Bereich des Lernens und die Erwachsenenbildung genommen. Die rasante Anhäufung von Wissensbeständen, die Entwicklung neuer Technologien, die Erfordernis nach Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an neue Herausforderungen sowie das Gebot des lebenslangen Lernens sind nur einige der richtungweisenden Faktoren, die sich auf die jüngste Entwicklung von Lernprozessen auswirken. Diese Veränderungen innerhalb der Gesellschaft sowie im Berufswesen führen dazu, dass traditionelles Lernen immer häufiger nicht mehr den erwünschten Lernerfolg erzielt. Doch erst die Thesen der konstruktivistischen Lerntheorie, nach denen Lehre nicht zwangsläufig zum Lernen führt, Lernen grundsätzlich nur selbstgesteuert glücken und Lehre Lernen sogar ‚behindern’ kann, führten dazu, die Lehrorientierung in der Didaktik generell zu hinterfragen und nach einer neuen Lernkultur zu suchen, „die – wie der Name schon sagt – eine Lern- und keine Lehrkultur“ ist.
Die vorliegende Masterarbeit fokussiert sich genau auf den Spagat zwischen dem Wandel der Lernkultur und den daraus resultierenden neuen Anforderungen an die Erwachsenenbildung. Dabei werden zuerst der Weg zum Lernkulturwandel sowie dessen wesentlichen Merkmale untersucht: Welche gesellschaftlichen Faktoren führten zu einem Wandel der Lernkultur? Welche Entwicklungsschritte können wir dabei verfolgen? Und wie grenzt sich die neue gegenüber der traditionellen Lernkultur ab?
Das zweite Kapitel ist zugleich auch die Motivation und Zielsetzung dieser Masterarbeit. Hier soll herausgestellt werden, welche Konsequenzen der Lernkulturwandel für die Praxis der Erwachsenenbildung hat und vor welchen Herausforderungen und Aufgaben der moderne Didaktiker steht. In diesem Zusammenhang wird auch das Selbstverständnis und Berufsbild des Erwachsenenbildners unter die Lupe genommen. Zum Schluss sollen konkrete didaktische Hinweise und Lösungsmöglichkeiten gegeben werden, die dem Erwachsenenbildner zeigen, auf welche Art und Weise, mit welchen didaktischen Prinzipien und Methoden er dem Lernkulturwandel begegnen kann.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Lernkultur - Eine Begriffsbestimmung
3. Lernkulturwandel - Der Weg zu einer neuen Lernkultur
3.1 Gesellschaftliche Faktoren des Lernkulturwandels - Von der Industriegesellschaft zur modernen Informations- und Wissensgesellschaft
3.2 Vom „autodidactic“ zum „facilitative turn“ - Selbstlernfähigkeiten als lebensnotwendige Kompetenz
3.3 Die neue Lernkultur - Abkehr von traditionellen Lehr- und Lernmustern
4. Anforderungen an die Erwachsenenbildung - Lehren und Lernen heute
4.1 Kernprobleme und Herausforderungen
4.2 Der Lehrende als Lernarrangeur - Beratung statt Belehrung
4.3 Didaktisches Handeln konkret: Lehrkultur in Zeiten der Lernkultur
5. Hat sich die Erwachsenenbildung auf den Lernkulturwandel eingestellt? (Schlussbetrachtung)
Literaturverzeichnis