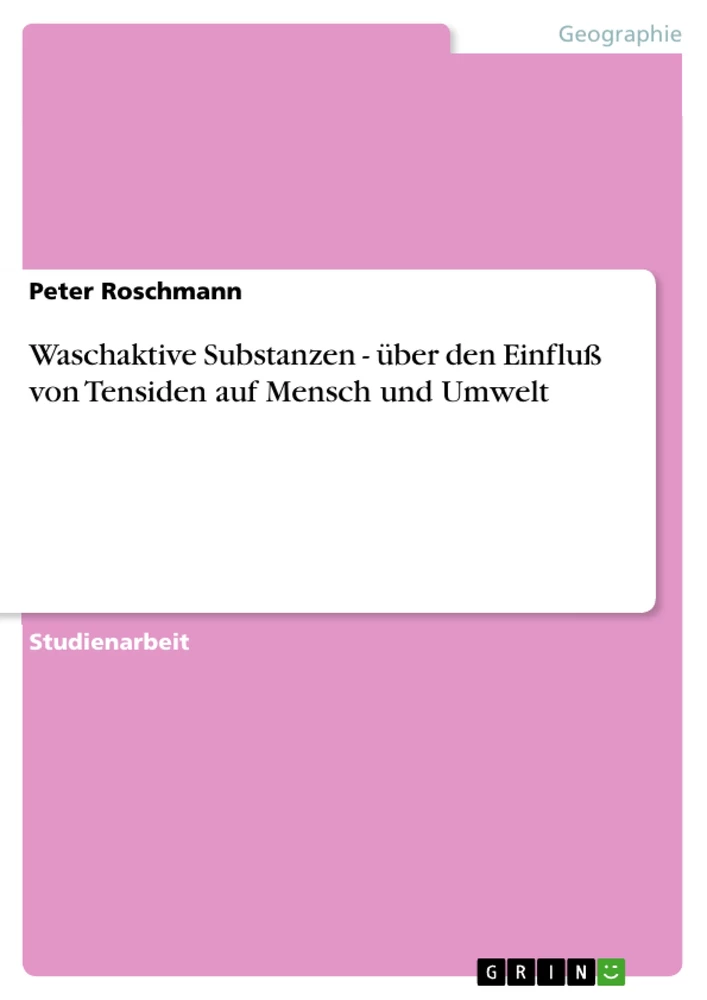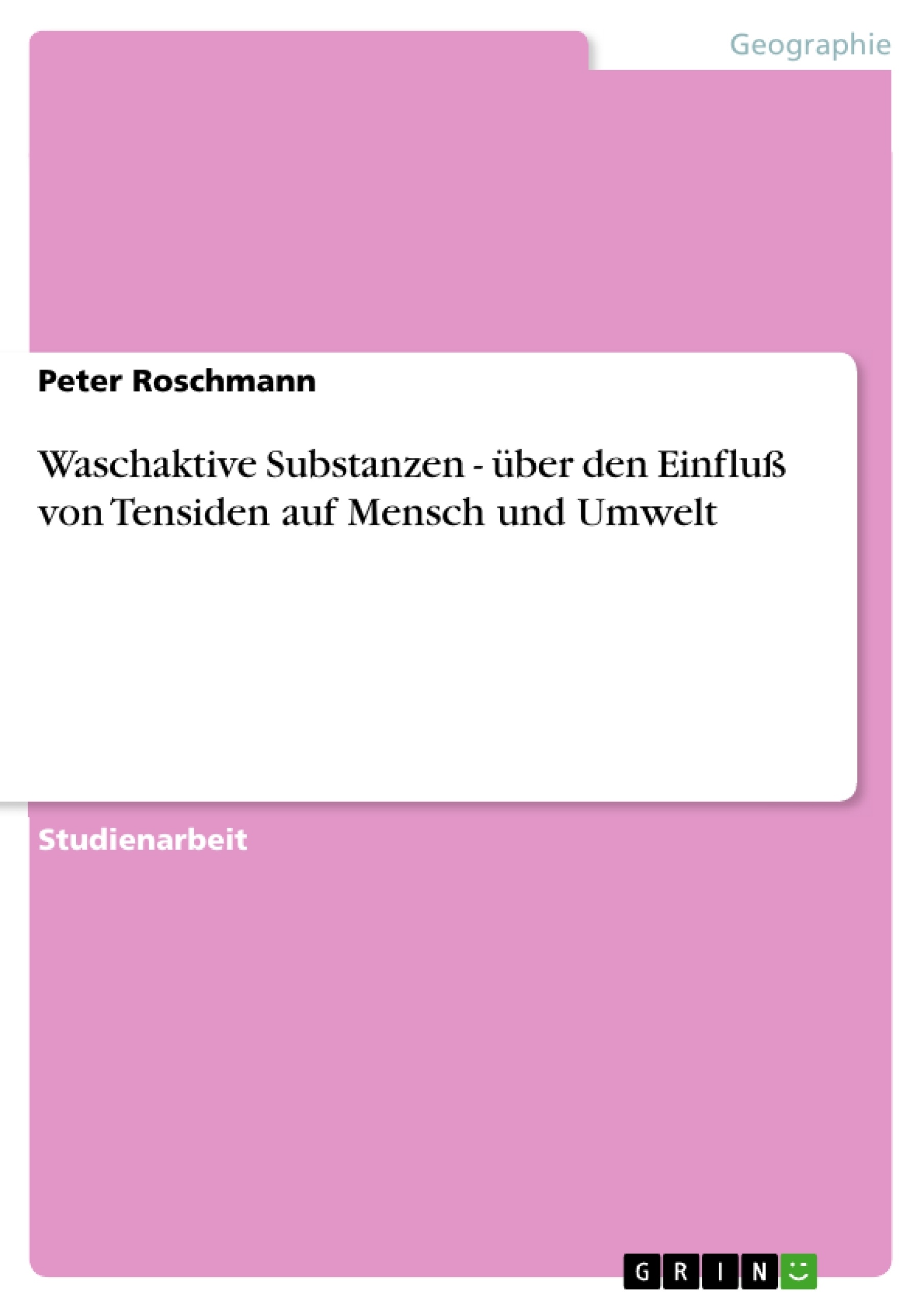[...] Im Zuge dieser Arbeit wird auf die Klasse der „Waschaktiven Substanzen“ oder „Waschaktiven Chemikalien“ eingegangen, die im Frühjahr 2006 wieder in die Öffentlichkeit gelangten, als im Hochsauerlandkreis in der Ruhr sowie im Grund- und Trinkwasser Perfluorierte Tenside (PFT) in erhöhter Konzentration aufgetreten sind. Über Nebenwirkungen von Tensiden wurde bereits in den 1960ern berichtet, als Gewässer überall auf der Erde in meterhohen Schaumbergen verschwanden...
Auf die Akkumulation von Tensiden in kontaminiertem Trink- und Abwasser sowie in Klärschlamm und Böden wird im Laufe dieser Arbeit Bezug genommen und versucht, sich dem Verständnis für den Aufbau, die Struktur und den Eigenschaften von Tensiden anzunähern. Ferner wird ein Überblick über die verschiedenen Verbindungen von Tensiden gegeben und eine Analyse über die Toxizität genannter Stoffe ausgeführt [...]
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Was sind Tenside
2.1 Beschreibung
2.2 Struktur und Aufbau
2.3 Klassifizierung
3 Ökologische Aspekte von Tensiden
3.1 Bewertung der Toxizität
3.1.1 Perfluorierte Tenside
3.1.2 Nonylphenol
3.2 Stoffeintrag in Böden und Gewässer
4 Einflüsse auf Mensch und Natur
4.1 Beispiel PFT: Cholesterinerhöhung bei Kindern
4.2 Yamuna, der „tote Fluss"
5 Zusammenfassung und Ausblick
6 Literatur