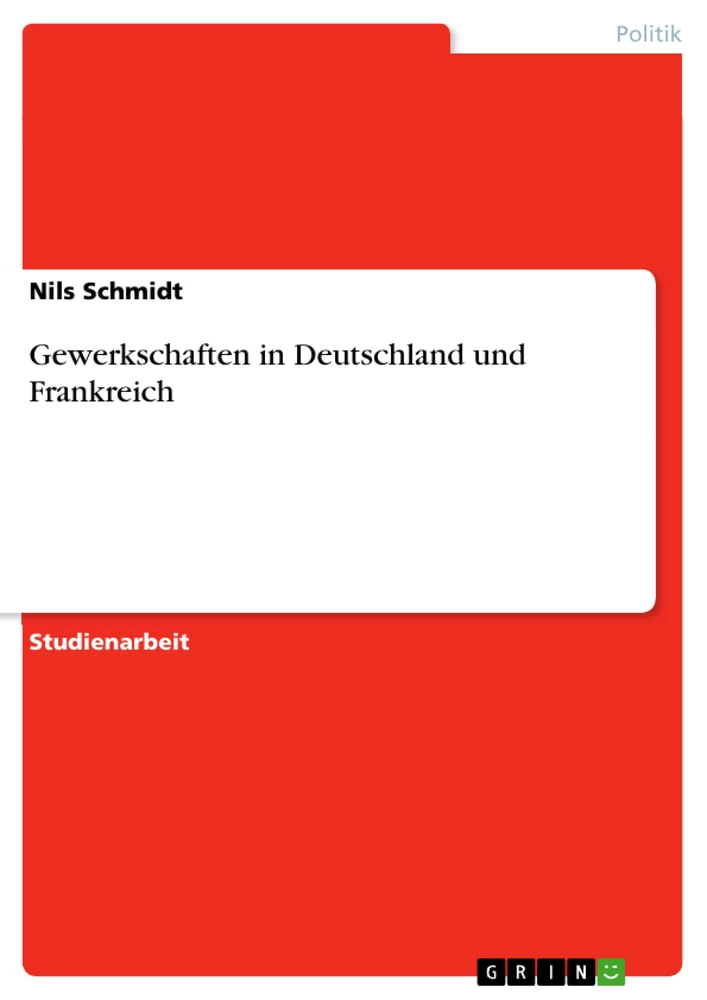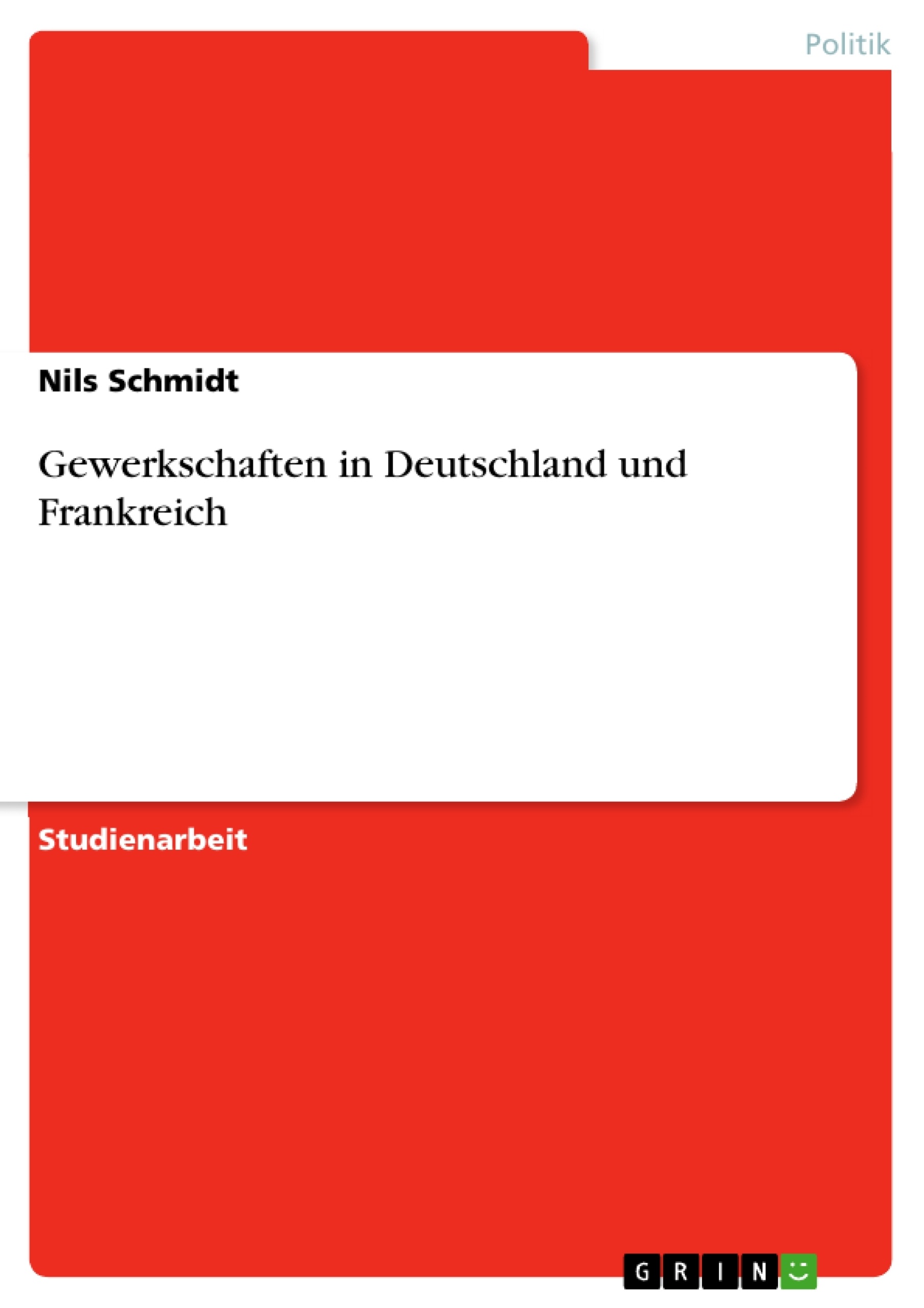Die Gewerkschaft ist eine der bedeutendsten Formen der organisierten Interessenvertretung. Sie dient der Artikulation von Arbeitnehmerinteressen gegenüber der Arbeitgeberseite und der Regierung. Gewerkschaften können, wie alle Verbände, als eine für eine Demokratie konstituierende Institution gelten. Sie übernehmen eine wichtige Funktion in der Aggregation von Arbeitnehmerinteressen und haben erheblichen Einfluss auf politische Entscheidungen. Dennoch befinden sich die Gewerkschaften in fast allen Ländern Westeuropas nachweislich in einer Krise. Es sind vielfach deutlich sinkende Organisationsgrade der Gewerkschaften zu beobachten. Genauso vielfältig wie die Ursachen für die Krise und deren Auswirkungen, sind auch die Strategien der Gewerkschaften, mit denen sie ihren Problemen zu begegnen versuchen.
In dieser Hausarbeit werden die grundlegenden Problemstellungen der gewerkschaftlichen Interessensartikulation und die Ursachen und Folgen der Krise der Gewerkschaften in Westeuropa sowie die Bemühungen, den negativen Trend umzukehren, thematisiert.
Gliederung
1 Einleitung
2 Gewerkschaftliche Herausforderungen
2.1 Grundlegende Problemstellungen
2.2 Situation der deutschen Gewerkschaften
2.3 Situation der französischen Gewerkschaften
3 Gewerkschaftliche Strategien zur Krisenbewältigung
3.1 Allgemeine Befunde
3.2 Deutsche Gewerkschaften
3.3 Französische Gewerkschaften
4 Fazit und Ausblick
5 Literatur