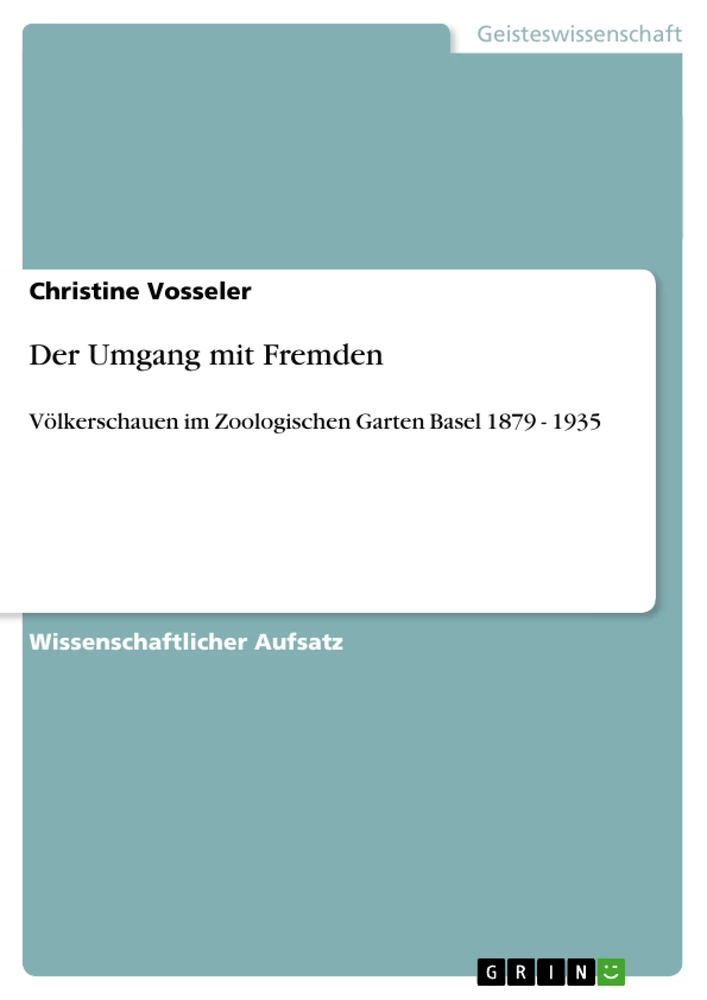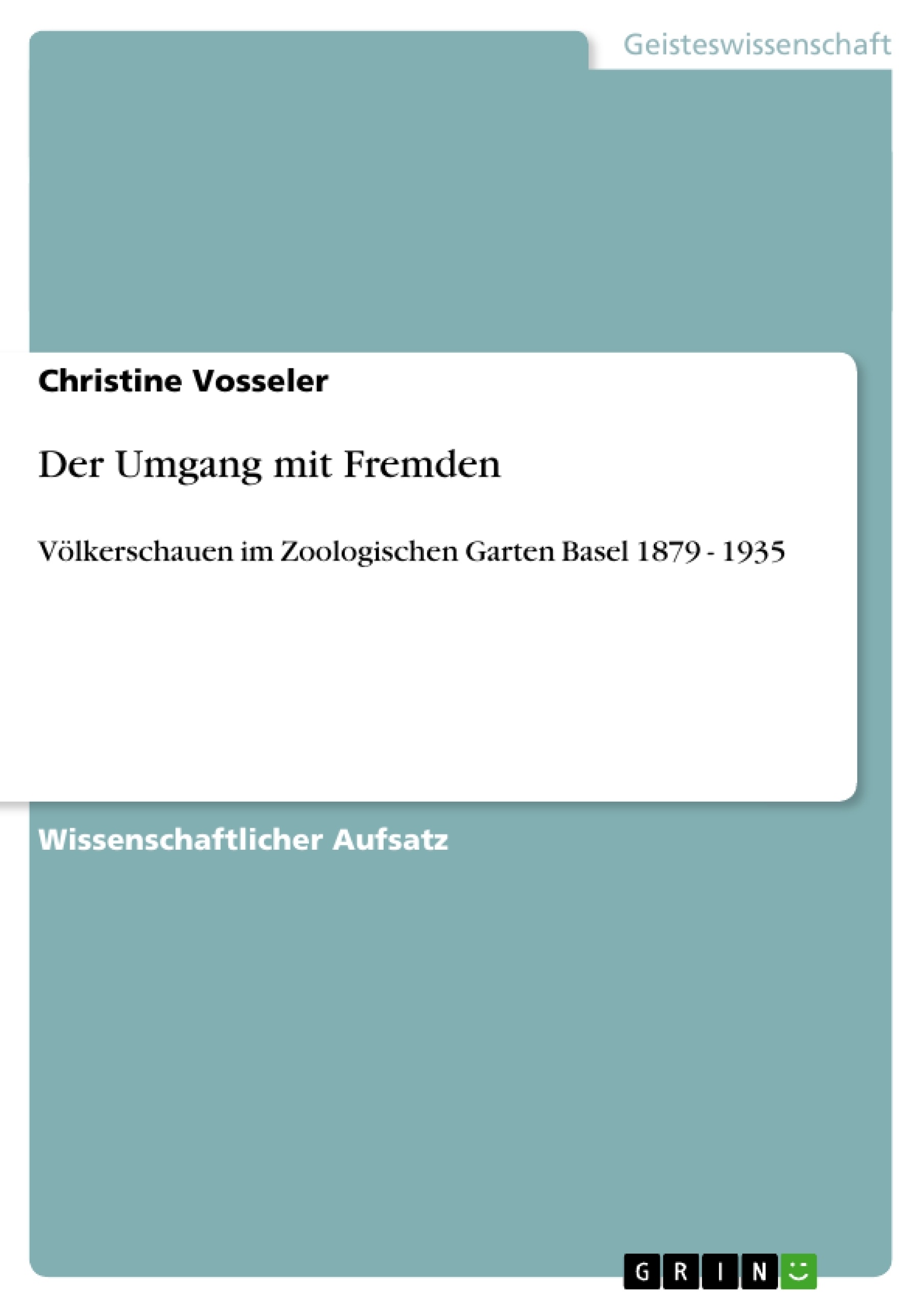Das Europa des ausgehenden 19. und des beginnenden 20. Jahrhunderts befand sich in einem Wandel. Die Industrialisie-rung brachte ein Bürgertum hervor, das seine Stellung inner-halb der Gesellschaft festigen musste und nach Legitimie-rung suchte. Die Kolonialisierung der Welt durch die europäi-sche Nationalstaaten, die noch jung waren und erst ein Nati-onalbewusstsein generieren mussten, wie auch die, von (ökonomischen) Nutzen geprägte, eurozentristische Haltung fanden in den sozialdarwinistischen Theorien den hinrei-chend Gründe zur Rechtfertigung ihres, aus heutiger Sicht überhöhten Status. Anhand der Völkerschauen im Zoologi-schen Garten Basel 1879 – 1935 wird diese Entwicklung auf-gezeigt und nach einem Fazit auf die berufspraktische Rele-vanz der Sozialen Arbeit bezogen.
Inhalt
1. Einleitung
2. Völkerschauen
2.1. Beschreibung der Völkerschauen im Zoologischen Garten Basel
2.2. Zurschaustellung von Fremden im Verlauf der Geschichte
3. Zeitgeist: Kultur- und Rassentheorien
4. Schlussfolgerungen
5. berufspraktische Relevanz
Literaturangaben
1. Einleitung
Die Art und Weise wie wir mit Fremdem umgehen und wie wir uns gegenüber Menschen aus anderen Kulturen und Ethnien verhalten, ist geprägt von unserem Menschenbild, von unseren Werten und Normvorstellungen. Diese wiederum verändern sich im Laufe der Zeit und spiegeln den herrschenden Zeitgeist, die kulturellen Bedingungen. Kultur beschreibt die kohärenten, individuellen und gesellschaftlichen Handlungs- und Deutungsmuster und ist als Prozess zu verstehen, da sie sich laufend wandelt. Ethnos kommt aus dem Griechischen, bedeutet ursprünglich Volk und fasst die Mitglieder einer Ethnie zu einer kollektiven Identität zusammen (Duden 2007: 291).
In diesem Text gehe ich der Frage nach dem, den Völkerschauen zugrunde liegenden, Kulturverständnis und dem ihm innewohnenden Rassismus nach. Es wird sich zeigen, wie wichtig der historische Hintergrund für die Ausbildung der entsprechenden Theorien war. Nach einem Fazit werden die Schlussfolgerungen bezüglich der berufspraktischen Relevanz der Sozialen Arbeit gedeutet.
Völkerschauen sind die Zurschaustellungen von vorwiegend aussereuropäischen Menschen aus fernen, exotischen Ländern meist in Zoologischen Gärten. Diese Inszenierungen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bis vor den 2. Weltkrieg, mit einem Unterbruch während des 1. Weltkrieges, waren primär ökonomisch begründet. Im Schnitt wurden mit diesen Inszenierungen 20 - 25 % der Jahreseinnahmen des Zoologischen Gartens generiert (vgl. Staehelin 1993: 47). Seit Beginn erregten die Ausstellungen die grosse Aufmerksamkeit der Wissenschaftskreise (vgl. ebd.: 107). Wurden Völkerschauen von Wissenschaftlern damals als wissenschaftlich betrachtet, beurteilen wir sie heute als diskriminierend. Im Bewusstsein der Zeitgenossen scheint diese eher düstere Auseinandersetzung mit Menschen anderer Ethnizität nicht zu sein. Junge Menschen können sich diese Begebenheiten nicht vorstellen, die ältere Generation schweigt und verdrängt. In der wissenschaftlichen Literatur wird das Thema fast gar nicht aufgegriffen.
2. Völkerschauen
2.1. Beschreibung der Völkerschauen im Zoologischen Garten Basel
Von 1879 bis 1935 wurden im Zoologischen Garten Basel einundzwanzig Völkerschauen gezeigt, diese dauerten zwischen 12 und 86 Tagen (vgl. Staehelin 1993: 11). Sie wurden mit „Rice-Hagenbecksche Nubier-Karavane", „Austral-Neger Bonny", „Negerdorf aus dem Senegal", „Aussterbende Lippennegerinnen aus Zentralafrika" oder „Hagenbeck's anthropologisch-zoologische Kalmücken-Ausstellung" u.s.w. betitelt. An der Namengebung zeigt sich das ökonomische Interesse der Veranstalter. Die Schauen befriedigten das Bedürfnis der Besucher nach Exotik und auch nach Erotik, Frauen mussten sich oft mit entblösstem Oberkörper zeigen. Obwohl die Inszenierungen frei erfunden waren, vermittelten sie den Anschein die Lebenswelt anderer Kulturen darzustellen und suchten so den wissenschaftlichen Wert der Ausstellungen zu begründen. Oft bereisten die Truppen auch andere Schweizer Städte und tourten durch ganz Europa (vgl. ebd.: 156f). Verschiedene Impressarios übernahmen die Organisation, warben die Darstellenden an und setzten sie unter Vertrag. Über die Anwerbung und die Entlöhnung sind fast keine Quellen vorhanden. Es ist aber in den meisten Fällen davon auszugehen, dass die zur Schau gestellten Menschen nicht zwangsweise verschleppt wurden. Die ersten Darsteller, die an diesen Inszenierungen mitwirkten, waren Begleitpersonen bei Tiertransporten. Daraus entwickelten sich diese Völkerschauen mit und ohne Beteiligung von Tieren.
„Grösstenteils stammten die ausgestellten Menschen aus Afrika (16 Schauen), weniger häufig aus Russland (3 Schauen), Ceylon (2 Schauen) und Australien (1 Schau). Nicht alle gezeigten Menschen waren Bewohner europäischer Kolonien." (Staehelin 1993: 37f). Zu Beginn war die Grösse der Truppen noch relativ klein, zwischen sechs und zwanzig Personen, später wuchs sie bis zu sechzig bis siebzig Personen an (vgl. ebd.: 37). Da sie das „Familienleben" darstellen sollten, wurde darauf geachtet, möglichst alle Altersgruppen und auch Angehörige beiderlei Geschlechts in der Truppe zu haben.
Die Bedingungen der Ausgestellten waren schrecklich. „Es kann nur darüber spekuliert werden, was die Ausgestellten empfunden haben mögen, halbnackt in einer im Zoo gelegenen Umzäunung aufzutreten, die von einer schaulustigen Menschenmenge umlagert wurde." (ebd.: 78). Auch wenn die zur Schau gestellten Menschen nicht in den zur Ausstellung gehörenden Hütten und Zelten übernachten mussten, waren die Unterbringungen schlecht und menschenunwürdig. Sie lebten zusammengepfercht in Holzhütten oder Ställen. 1891 wurde beispielsweise eine Gruppe von 30 Personen in einer Holzhütte, die 15m lang und 5m breit war, untergebracht (vgl. ebd.: 79). Diese miserablen Bedingungen trugen dazu bei, dass viele Mitglieder krank wurden und einige verstarben. Auch das Tragen landesüblicher Bekleidung, vor allem bei kalten Temperaturen und schlechter Witterung, war eine grosse Strapaze.
Die Völkerschauen sollten die Evolution mit allen Sinnen erfahrbar machen. Die Ausgestellten spielten ihr heimatliches Leben mit ihren Festen und Riten. Die Darbietungen bildeten aber nicht den reellen Alltag ab, sondern orientierten sich am Bild, das die europäischen Zuschauer von den Lebensumständen der zur Schau gestellten hatten (vgl. ebd.: 28f). Den Besuchern wurde so die „Überlegenheit" der in Europa hervorgebrachten Zivilisation vermittelt.