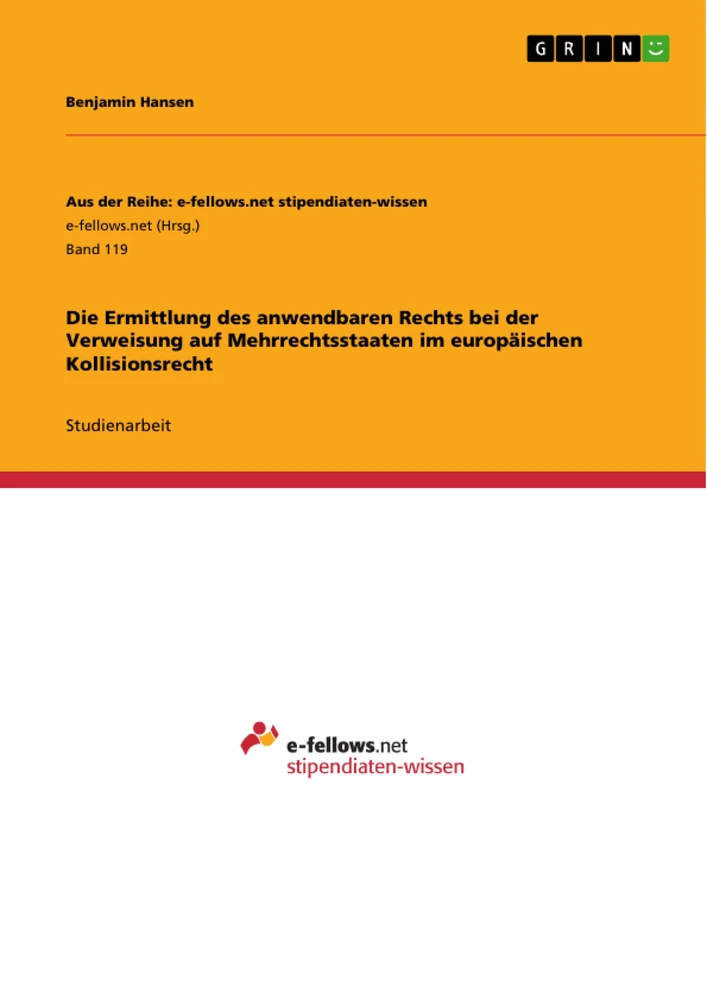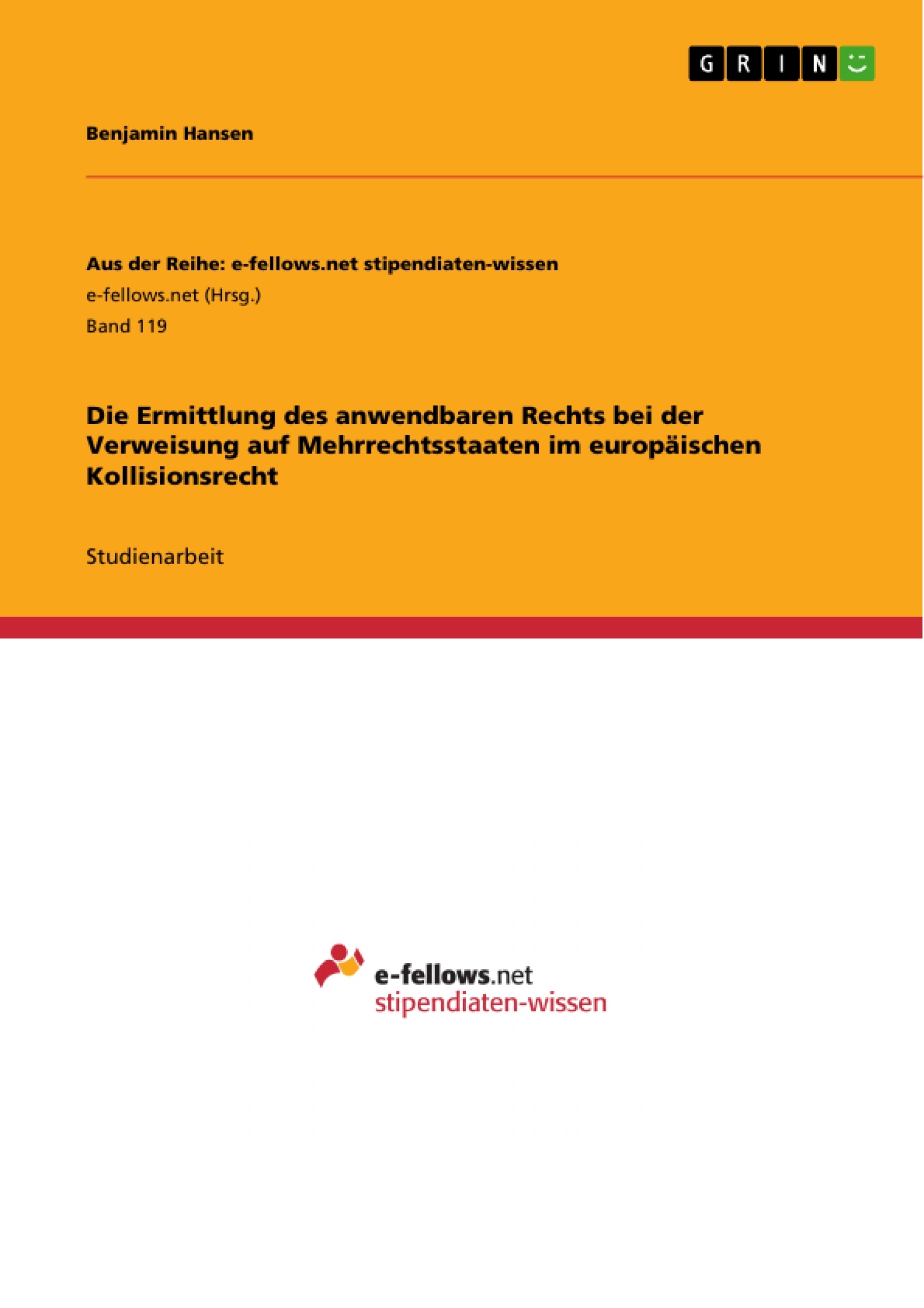Wenn in Europa auch noch nicht die Bereitschaft besteht, einheitliche Regelwerke im materiellen Recht zu schaffen,so schreitet doch die Vereinheitlichung der Kollisionsnormen auf unionsrechtlicher Ebene mit großen Schritten voran. So findet sich im europäischen Kollisionsrecht heute bereits für die meisten Rechtsmaterien eine entsprechende Verordnung oder zumindest ein Verordnungsvorschlag. Dabei wurden die Allgemeinen Lehren des Internationalen Privatrechts bisher eher vernachlässigt. So gibt es in besagten Verordnungen zwar einzelne Regelungen; jedoch gibt es bisher noch keine „Rom 0-VO“ zum Allgemeinen Teil des Internationalen Privatrechts im europäischen Kollisionsrecht und auch noch keine konkreten Pläne zu einer derartigen Kodifikation. Allerdings erfordert die sich stets erhöhende Mobilität der Bürger im europäischen Rechtsraum und die damit verbundene Zunahme an grenzüberschreitenden Rechtsverhältnissen auch eine zu mehr Rechtssicherheit führende einheitliche Anwendung der Allgemeinen Lehren des Internationalen Privatrechts auf unionsrechtlicher Ebene.
Die Ermittlung des anwendbaren Rechts bei der Verweisung auf Mehrrechtsstaaten gehört zu den klassischen Fragestellungen im Allgemeinen Teil des Internationalen Privatrechts. Die Relevanz dieses Problems kommt nicht zuletzt dadurch zum Ausdruck, dass sich entsprechende Regelungen nicht nur in den meisten nationalen Rechtsordnungen der europäischen Mitgliedstaaten, sondern auch in der staatsvertraglichen Praxis und im europäischen Kollisionsrecht finden. Gerade in der staatsvertraglichen Praxis und im europäischen Kollisionsrecht lassen sich in jüngster Vergangenheit Entwicklungen erkennen, die zu immer differenzierteren Bestimmungen in den einzelnen Regelungswerken führen.
Gliederung
I. EINLEITUNG
II. BEGRIFF DES RÄUMLICH GESPALTENEN MEHRRECHTSSTAATES
III. DIE REICHWEITE DER ANKNÜPFUNGSENTSCHEIDUNG BEI DER VERWEISUNG AUF MEHRRECHTSSTAATEN
1. Staatsvertragliche Praxis
a) Europäisches Schuldvertragsübereinkommen von 1980
b) Haager interlokalrechtliche Formel
2. Europäisches Kollisionsrecht
a) Rom-Verordnungen
aa) Ortsbezogene Anknüpfung
bb) Staatsangehörigkeitsanknüpfung
b) Haager Unterhaltsprotokoll 2007
3. Zusammenfassung
4. VERHÄLTNIS
5. Bewertung
a) Ortsbezogene Anknüpfung
aa) Argumente für die Berücksichtigung interlokaler Kollisionsnormen
bb) Argumente für eine direkte Verweisung
cc) Differenzierende Lösung
b) Staatsangehörigkeitsanknüpfung
6. Auswirkungen auf das EGBGB
IV. DIE ANWENDUNG DES EUROPÄISCHEN KOLLISIONSRECHTS AUF INTERLOKALE KONFLIKTE IN MEHRRECHTSSTAATEN
1. Regelungsstand im Europäischen Kollisionsrecht
2. PRAXIS IN DEN EUROPÄISCHEN MEHRRECHTSSTAATEN
a) Das Vereinigte Königreich
b) Spanien
3. Bewertung
V. ZUSTÄNDIGKEIT DES EUGH BEI FREIWILLIGER ANWENDUNG EUROPÄISCHEN KOLLISIONSRECHTS AUF INTERLOKALE KONFLIKTE IN MEHRRECHTSSTAATEN
1. Rechtsprechung des EuGH
a) Die Dzodzi-Rechtsprechung
b) Kleinwort Benson
c) Leur-Bloem-Fälle
d) Zusammenfassung
2. Die Erstreckungsgesetze zu Rom I und II im Vereinigten Königreich
3. Bewertung
VI. FAZIT