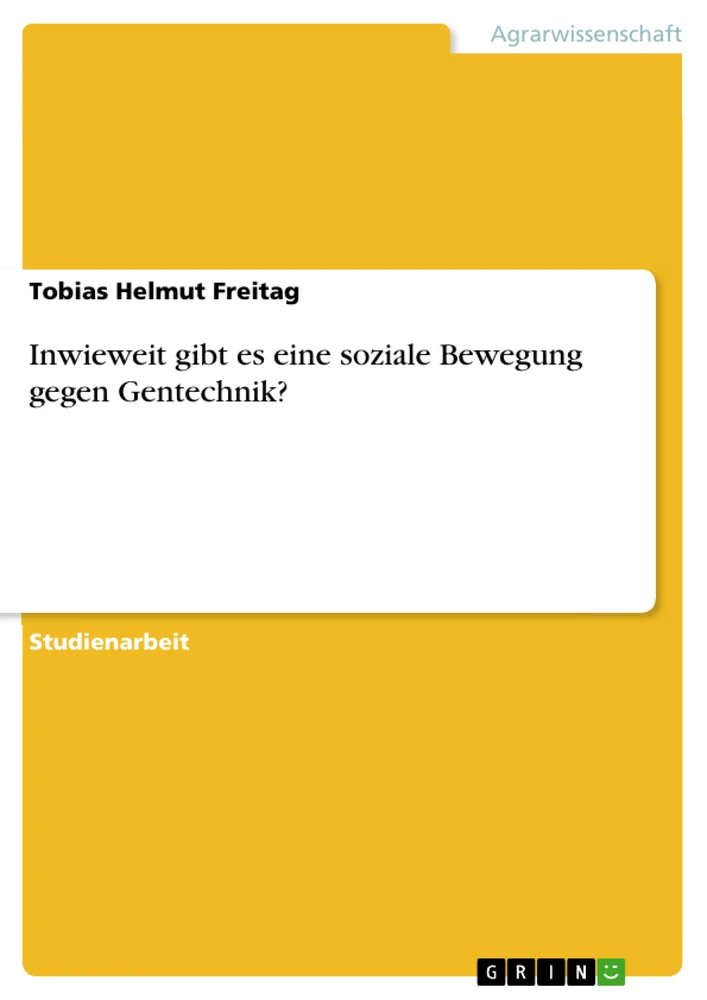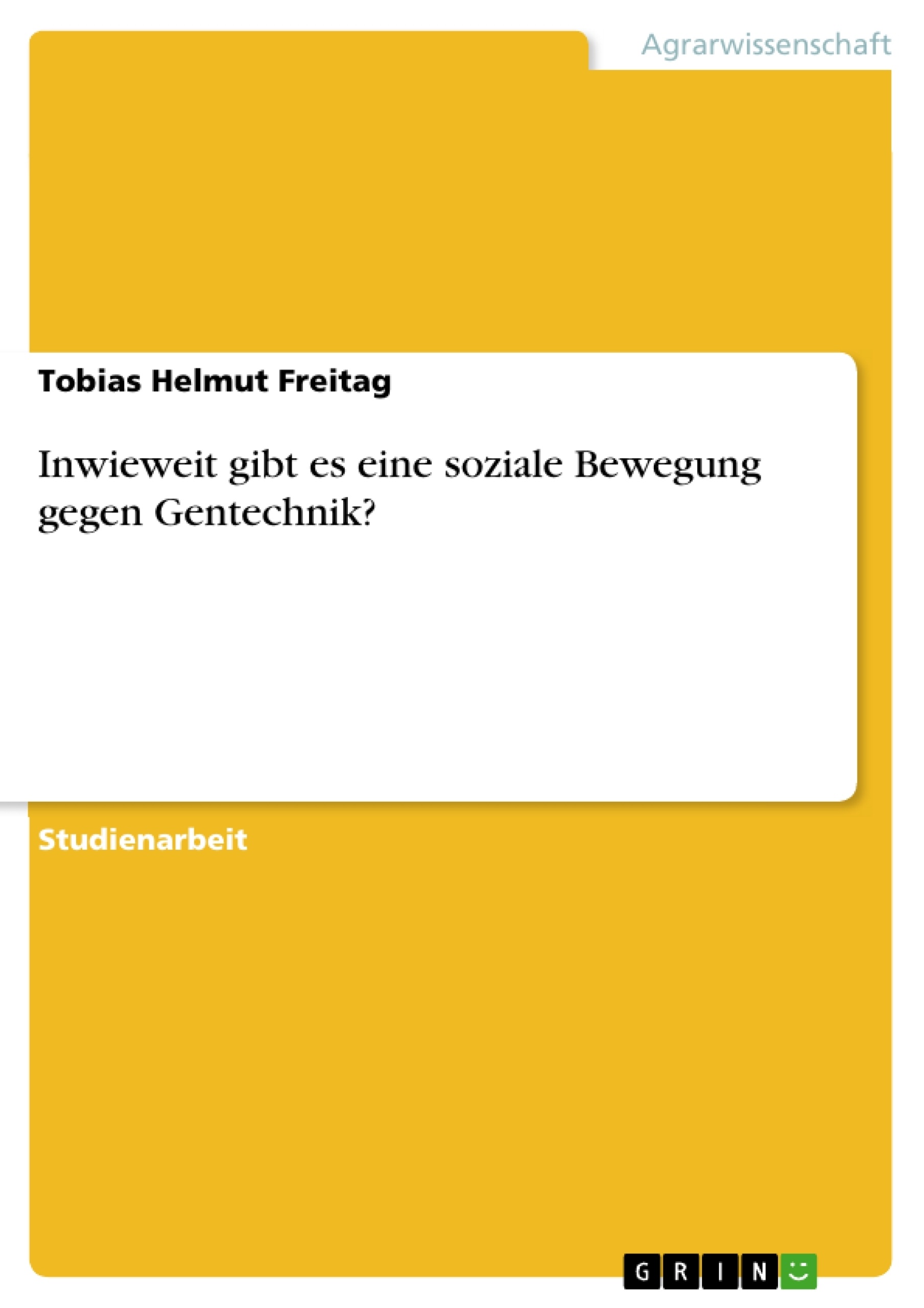Inhalt dieser Seminararbeit ist eine Defintion der Gentechnik und Sozialer Bewegungen. Der Fokus liegt jedoch auf der Beschreibung von Einflussgrößen in Bezug auf die "Grüne Gentechnik", welche auf die Gesellschaft einwirken und sie nachhaltig beeinflussen. Es werden Non-Profit-Organisationen genannt, ihre Struktur und Zusammenwirken beschrieben. Neue und alte Methoden des Protests wie beispielsweise der Einsatz von Sozialen Netzwerken führen in der abschließenden Diskussion zu einer Bewertung, ob es zu einer Sozialen Bewegung gegen Gentechnik in Deutschland gekommen ist. Der Begriff ‚Protestindustrie‘ seitens der Non-Profit-Organisationen wird eingeführt.
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1 Einleitung
2 Gentechnik
3 Soziale Bewegungen
4 Gesellschaftliche Einflussgrößen auf soziale Bewegungen
5 Diskussion und Fazit
Literaturverzeichnis
Anhang