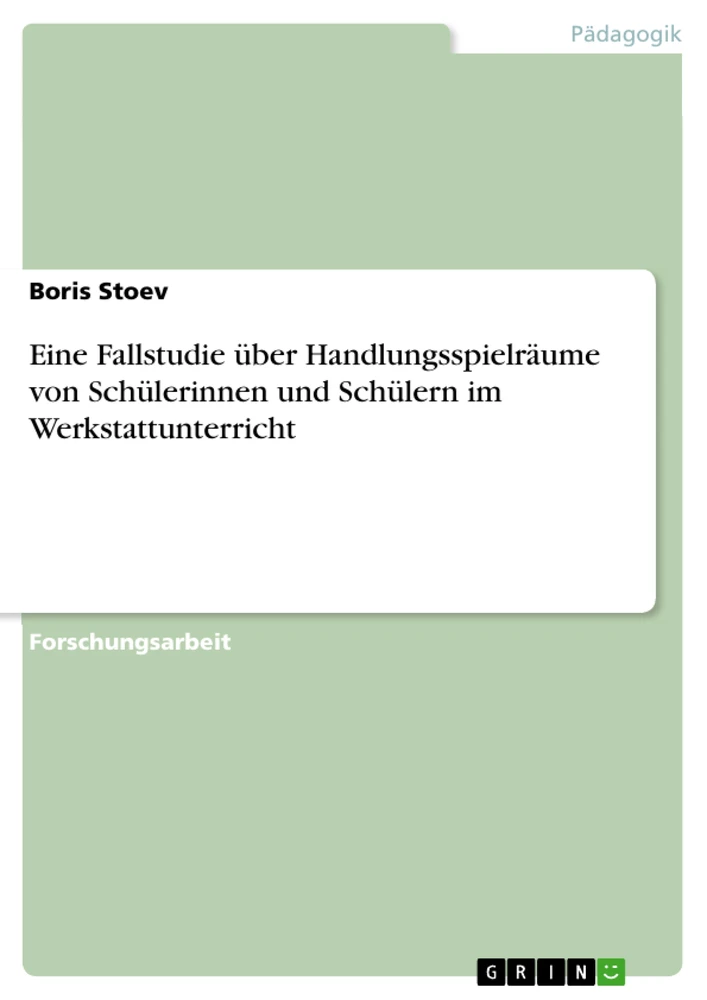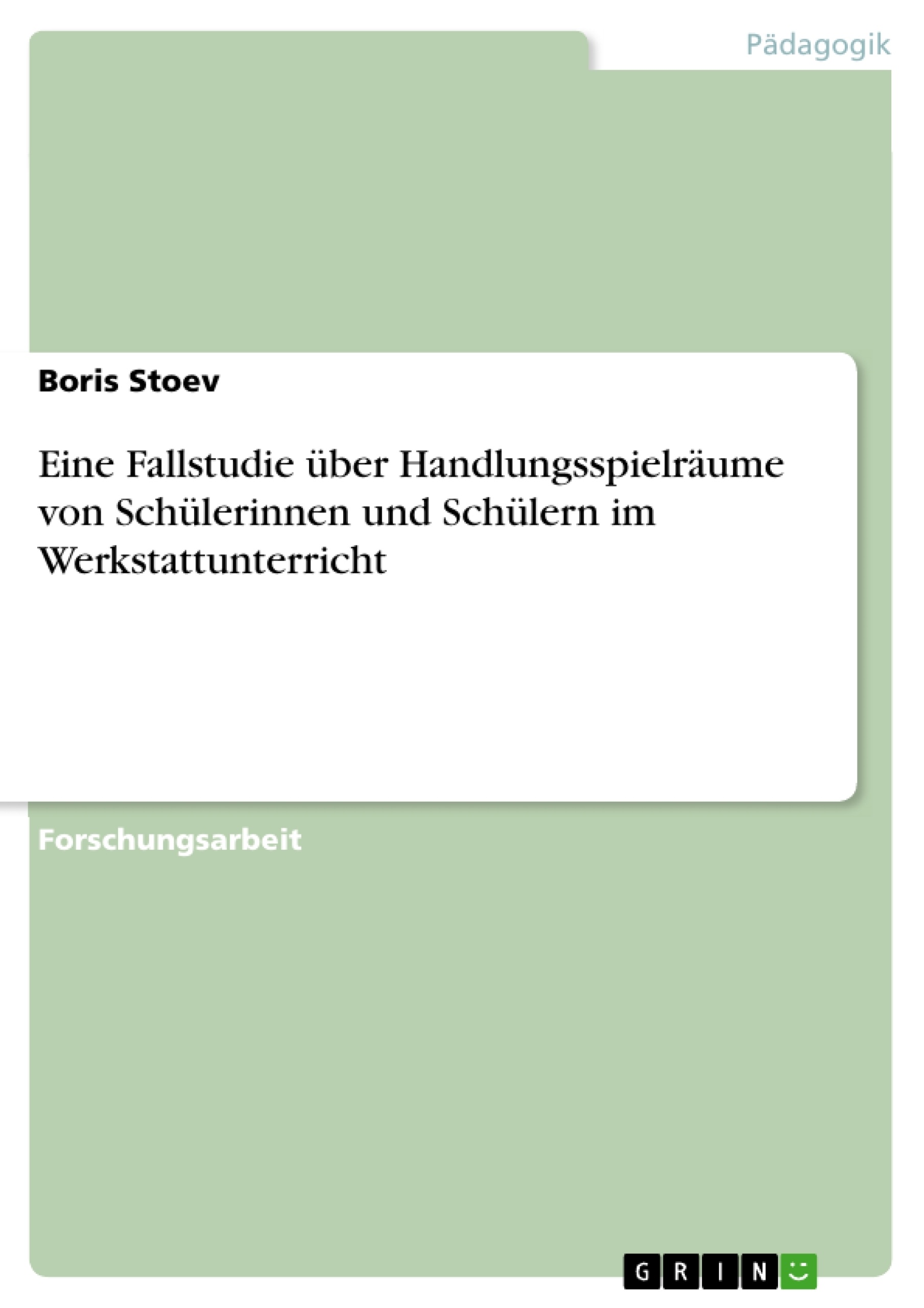1. Einführung in die Thematik
Gegenstand der Fallstudie sind die Handlungsspielräume von Schülerinnen und Schülern im Werkstattunterricht. Dabei liegen die Schwerpunkte auf dem Umgang mit dem Werkstattplan, der schriftlichen Arbeitsanweisung an sich und deren Verständnis und dem Arbeitsverhalten, bzw. dem Umgang mit Zeit der SchülerInnen.
Die Fallstudie ist im Rahmen des Seminars Offene Unterrichtsformen in der Grundschule zu sehen und soll auf der Basis einer selbst geplanten und durchgeführten Werkstatt entstehen. Die der Fallstudie vorrangegangene Praxisphase fand in einer 4. Klasse einer Grundschule in Bielefeld statt.
Ein Hauptziel des Werkstattkonzepts stellt die angestrebte Selbständigkeit und Eigenverantwortung der SchülerInnen dar. Bereits vor Beginn der Praxisphase interessierte mich, wie Kinder mit der Entscheidungsfreiheit, die der Werkstattunterricht bietet, umgehen. Dementsprechend setzte ich meine Beobachtungen an.
Inhaltsverzeichnis
1. Einführung in die Thematik
2. Theoretischer Rahmen des Werkstattunterrichts
3. Handlungsspielräume von Schülerinnen und Schülern im Werkstattunterricht
3.1 Vorstellung der Rahmenbedingungen des Werkstattunterrichts
3.2 Prozessverlauf der Praxisphase
3.3 Handlungsspielräume von Schülerinnen und Schülern im Werkstattunterricht am Beispiel des Umgangs mit dem Werkstattplan, den schriftlichen Arbeitsanweisungen und der Zeiteinteilung
3.3.1 Der Umgang mit dem Werkstattplan
3.3.2 Der Umgang mit der schriftlichen Arbeitsanweisung
3.3.3 Der Umgang mit Zeit
4. Zusammenfassung
5. Verwendete Literatur
6. Anhang