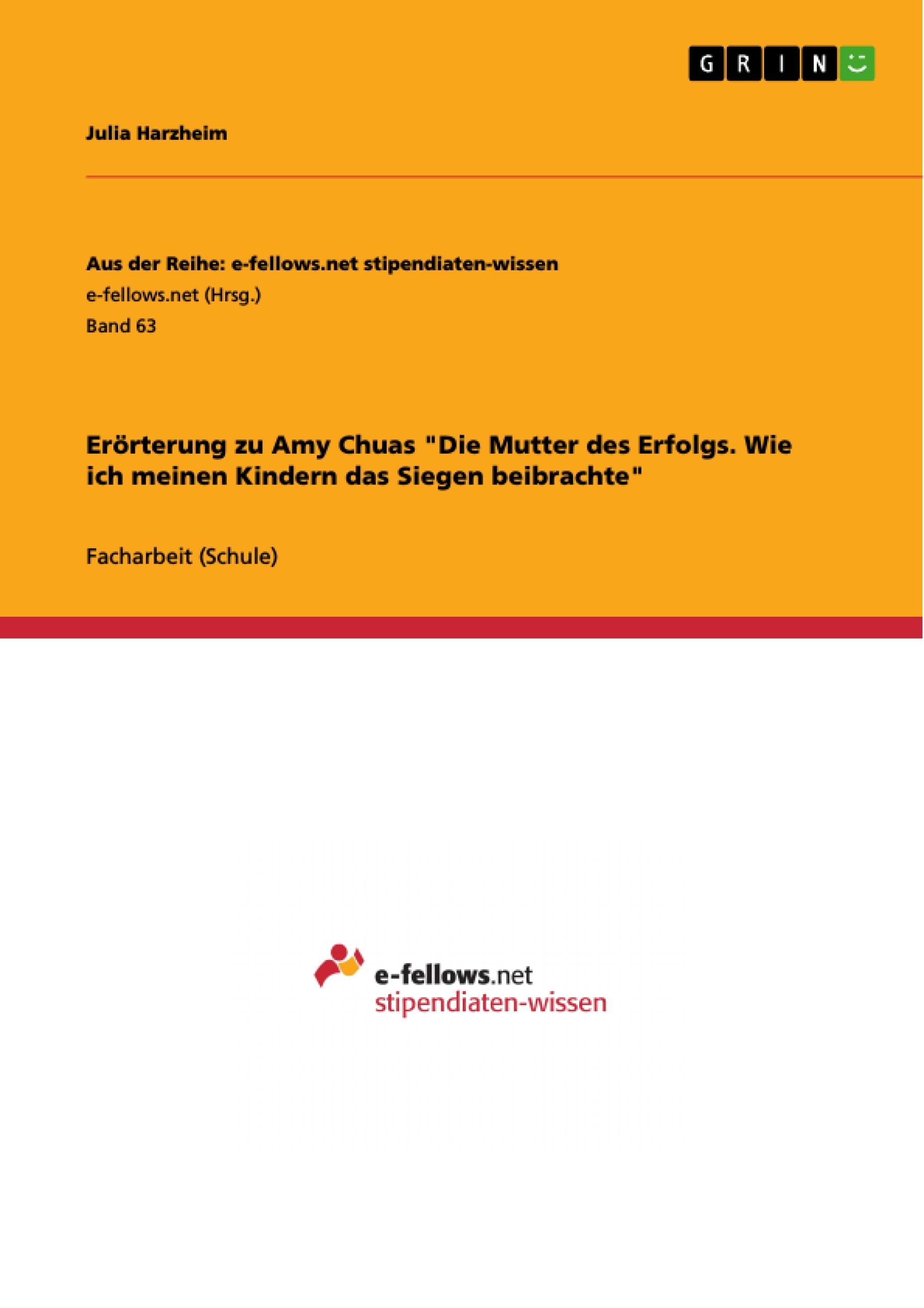Es handelt sich um eine Klausur aus der Oberstufe des allgemeinbildenden Gymnasiums im Fach Deutsch (Note: 1+ (15 Punkte)).
Bezugstext: Vorwort des Buches "Die Mutter des Erfolgs. Wie ich meinen Kindern das Siegen beibrachte" von Amy Chua.
Erörterung zu Amy Chuas "Die Mutter des Erfolgs. Wie ich meinen Kindern das Siegen beibrachte"
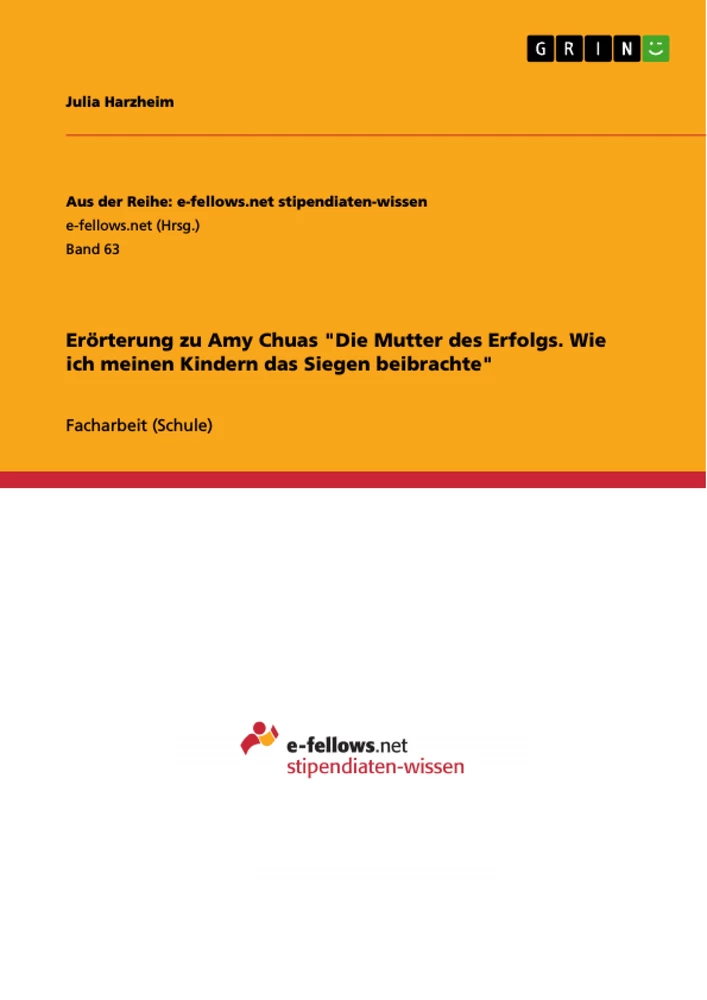
Facharbeit (Schule) , 2011 , 6 Seiten , Note: 0,75 (1+)
Autor:in: Julia Harzheim (Autor:in)
Didaktik für das Fach Deutsch - Erörterungen und Aufsätze
Leseprobe & Details Blick ins Buch