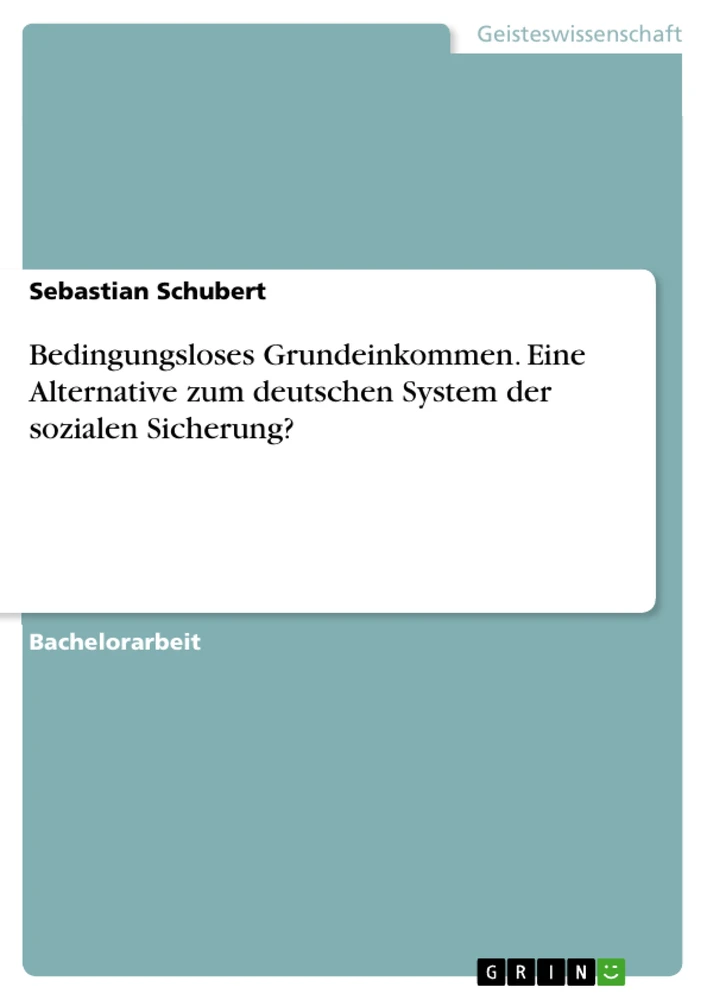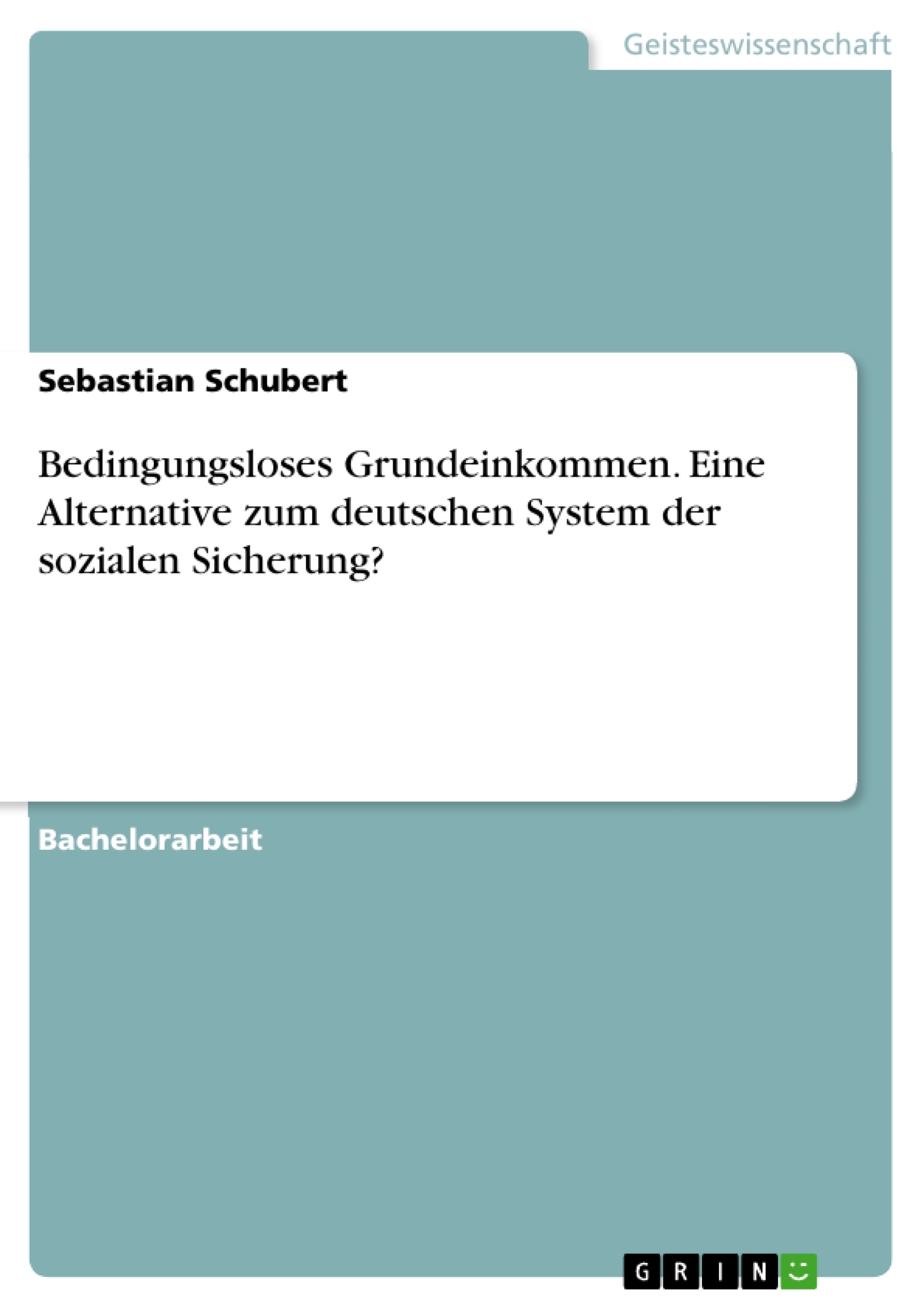Die vorliegende Arbeit untersucht, ob der vermehrt aufgegriffene Lösungsvorschlag eines Bedingungslosen Grundeinkommens tatsächlich eine Alternative zum bisherigen deutschen System der sozialen Sicherung mit seinen Komponenten Grundsicherung und Sozialversicherung darstellt oder ob es sich lediglich um immense Verschiebungen im Sozialbudget handelt, die ohne große Auswirkungen auf die vorhandenen Probleme bleiben.
Dazu wird in Kapitel 2 zunächst die Geschichte der Idee eines Bedingungslosen Grundeinkommens anhand der deutschen Debatte skizziert und dann das idealtypische Modell des Hamburgischen WeltWirtschaftsInstituts (HWWI) exemplarisch als eines der vielen
verschiedenen Konzepten zum BGE ausführlich vorgestellt. Kapitel 3 befasst sich anschließend mit dem aktuellen System der sozialen Sicherung in Deutschland und zeigt die Probleme auf, vor denen die Sozialversicherung steht und gibt eine kurze Einführung in das
Prinzip der Grundsicherung. In Kapitel 4 werden schließlich die gewonnenen Erkenntnisse gegenübergestellt, um anhand einer Diskussion der Vor- und Nachteile eines BGE nach Konzeption des HWWI zu einer Einschätzung zu gelangen, ob es sich wirklich um eine
Alternative handelt. Kapitel 5 beschließt die Arbeit und gibt einen Ausblick auf die weitere Thematik.
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1. Einleitung
2. Das Bedingungslose Grundeinkommen
2.1 Die deutsche Debatte
2.2 Das idealtypische Modell des Hamburgischen WeltWirtschaftsInstituts
2.2.1 Grundannahmen
2.2.2 Finanzbedarf
2.2.2.1 Variante 1A
2.2.2.2 Variante 1B
2.2.2.3 Variante 2A und 2B
2.2.3 Finanzierung
2.2.3.1 Variante 1A und 1B
2.2.3.2 Variante 2A und 2B
2.2.4 Arbeitsmarkteffekte
2.2.4.1 Arbeitsangebot
2.2.4.2 Arbeitsnachfrage
2.2.5 Zwischenfazit
3. Das bisherige System der sozialen Sicherung: Sozialversicherung und Grundsicherung
3.1 Krankenversicherung
3.2 Unfallversicherung
3.3 Rentenversicherung
3.4 Arbeitslosenversicherung
3.5 Pflegeversicherung
3.6 Probleme der Sozialversicherung
3.6.1 Demografischer Wandel
3.6.2 Atypische Beschäftigungsverhältnisse
3.7 Grundsicherung
3.8 Zwischenfazit
4. Das Bedingungslose Grundeinkommen als Alternative?
4.1 Finanzierung
4.2 Demografischer Wandel
4.3 Atypische Beschäftigungsverhältnisse
4.4 Bedürftigkeitsprüfung und Verwaltungskosten
4.5 Arbeitsmarktreaktionen
4.6 Systemübergang
4.7 Existenzsicherung
4.8 Schlussfolgerungen
5. Ausblick
Literatur- und Quellenverzeichnis