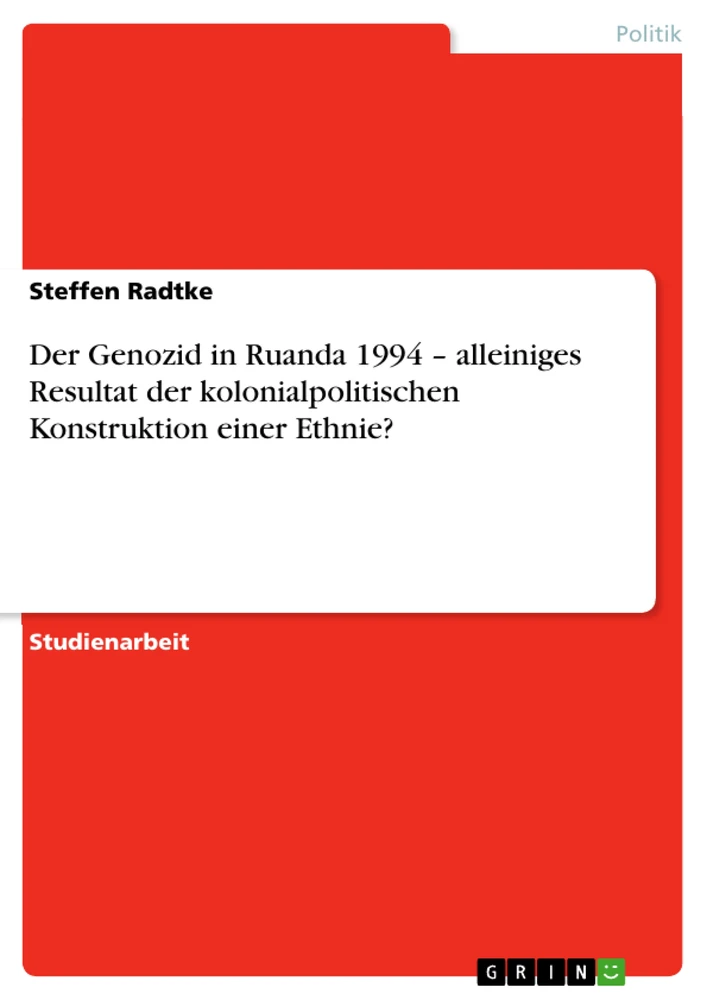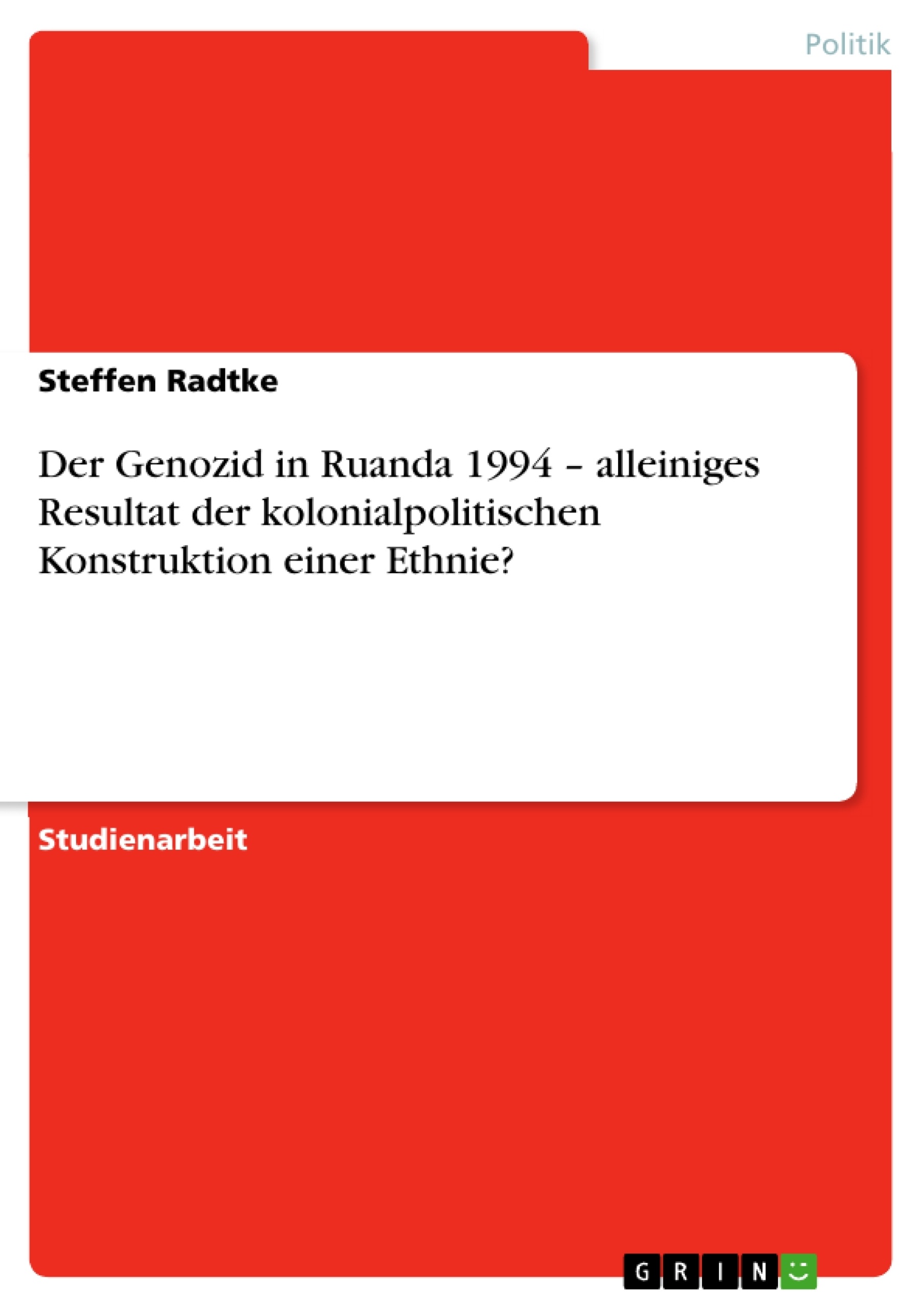Die vorliegende Arbeit widmet sich der Frage nach den Ursachen des Völkermordes von 1994, wobei im Zentrum die Überlegung steht, ob der er das alleinige Resultat der kolonialpolitischen Konstruktion einer Ethnie war.
Zuerst werden zur Einführung in die Thematik die Ereignisse im chronologischen Überblick seit der Unabhängigkeit Ruandas 1962 dargestellt. Das sich anschließende Kapitel beinhaltet dann die Untersuchung des Effektes von Feindbildern auf den Genozid. Um deren Wesen zu untersuchen, wird zunächst deren theoretische Vorbetrachtung unternommen. Im Anschluss daran erfolgt gemäß der Leitfrage die schwerpunktmäßige Analyse der kolonialpolitischen Konstruktion einer Ethnie, welche in der Konsequenz die Grundlegung von Feindbildern bedeutete. In einer Weiterführung dieser Analyse wird nachgezeichnet, wie durch die Politisierung der Ethnie im öffentlichen Diskurs ein weiterer Grundstein für die Ausprägung von ethnisch bedingten Feindbildern gesetzt wurde, bevor dann die politische Instrumentalisierung und explizite Formulierung drastischer Feindbilder genauer unter die Lupe genommen wird. Angesichts der enormen Grausamkeit der Ereignisse stellt sich zudem die Frage, welche weiteren, generalisierbaren Faktoren zum Genozid beigetragen haben. Aus diesem Grund wird an dieser Stelle eine kurze theoretische Zwischenbetrachtung vorgenommen. In einem weiteren thematischen Komplex werden dann neben den politischen Faktoren noch die sozialen genauer betrachtet. Den Ausgangspunkt dafür wird die Theorie von Thomas Robert Malthus bilden, der einen Zusammenhang zwischen Überbevölkerung und Nahrungsmittelknappheit feststellt. Im Zusammenhang der Transferierung dieses Grundgedankens auf die Situation in Ruanda werden die sozialen Faktoren des Genozids wie zum Beispiel die zu hohe Bevölkerungsdichte und Landknappheit untersucht, welche diesen strukturell begünstigt haben.
Der Aufsatz „Warum Völkermord in Ruanda?“ von Hartmut Dießenbacher stellte eine wichtige Literaturbasis dar. Seine Hypothese ist, dass der Völkermord infolge hoher Geburtenraten durch eine Überbevölkerung des Landes strukturell begünstigt wurde, sodass in der Konsequenz ein Zusammenhang von Zeugungs- und Tötungsverhalten konstatiert werden kann. Dieser demografische Ansatz ist in der Völkermordforschung noch relativ neu , gerade deshalb ist es aufschlussreich, den demografischen und sozialen Faktoren neben der politologischen Untersuchung von Feindbildern ein wenig Raum zu geben.
Inhaltsverzeichnis
1. Die genuine Irrationalität des Menschen
2. Chronologie des Genozids seit der Unabhängigkeit
3. Der Effekt von Feindbildern auf den Genozid
3.1 Theoretische Vorbetrachtungen zum Feindbild
3.2 Die Grundlegung von Feindbildern durch die kolonialpolitische Konstruktion einer Ethnie
3.3 Explizite Feindbilder
3.3.1 Die Politisierung der Ethnien im öffentlichen Diskurs
3.3.2 Die politische Instrumentalisierung und Ausformung der Feindbilder
3.3.3 Theoretische Deutungen des Genozids
4. Die Theorie von Thomas Robert Malthus
4.1 Das Bevölkerungsgesetz
4.2 Die Transferierbarkeit der Theorie auf Ruanda
5. Soziale Ursachen des Genozids
5.1 Ökologie, Bevölkerungswachstum und das Nahrungsproblem
5.2 Soziale Ungleichheit und vergiftetes soziales Klima
6. Rationalität des Irrationalen - Irrationalität des Rationalen
Anhang
Literatur- und Quellenverzeichnis