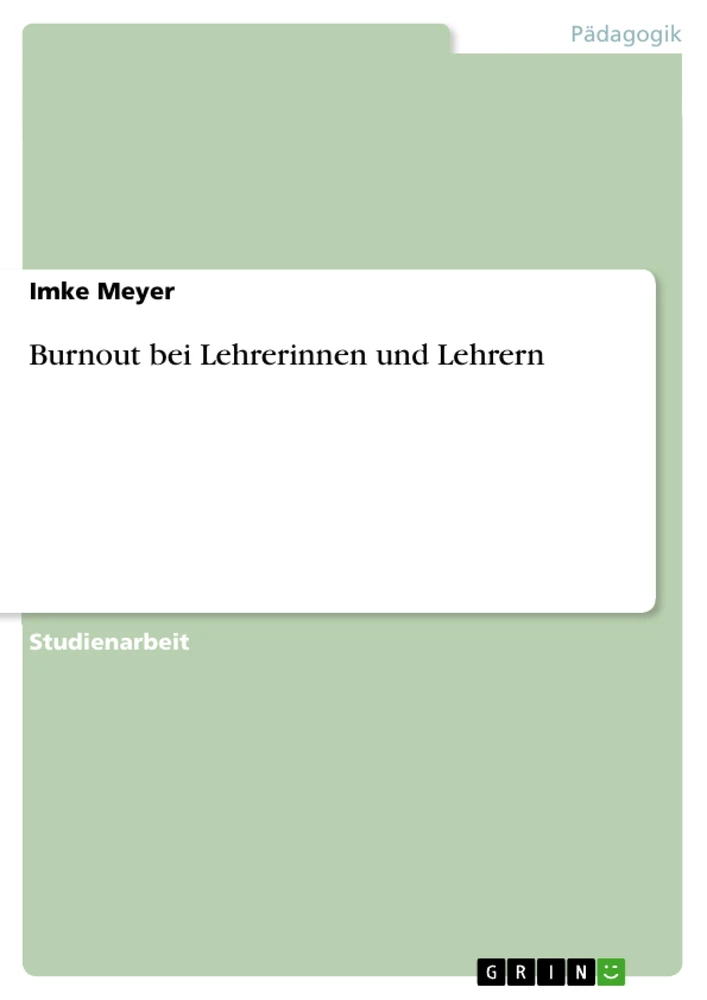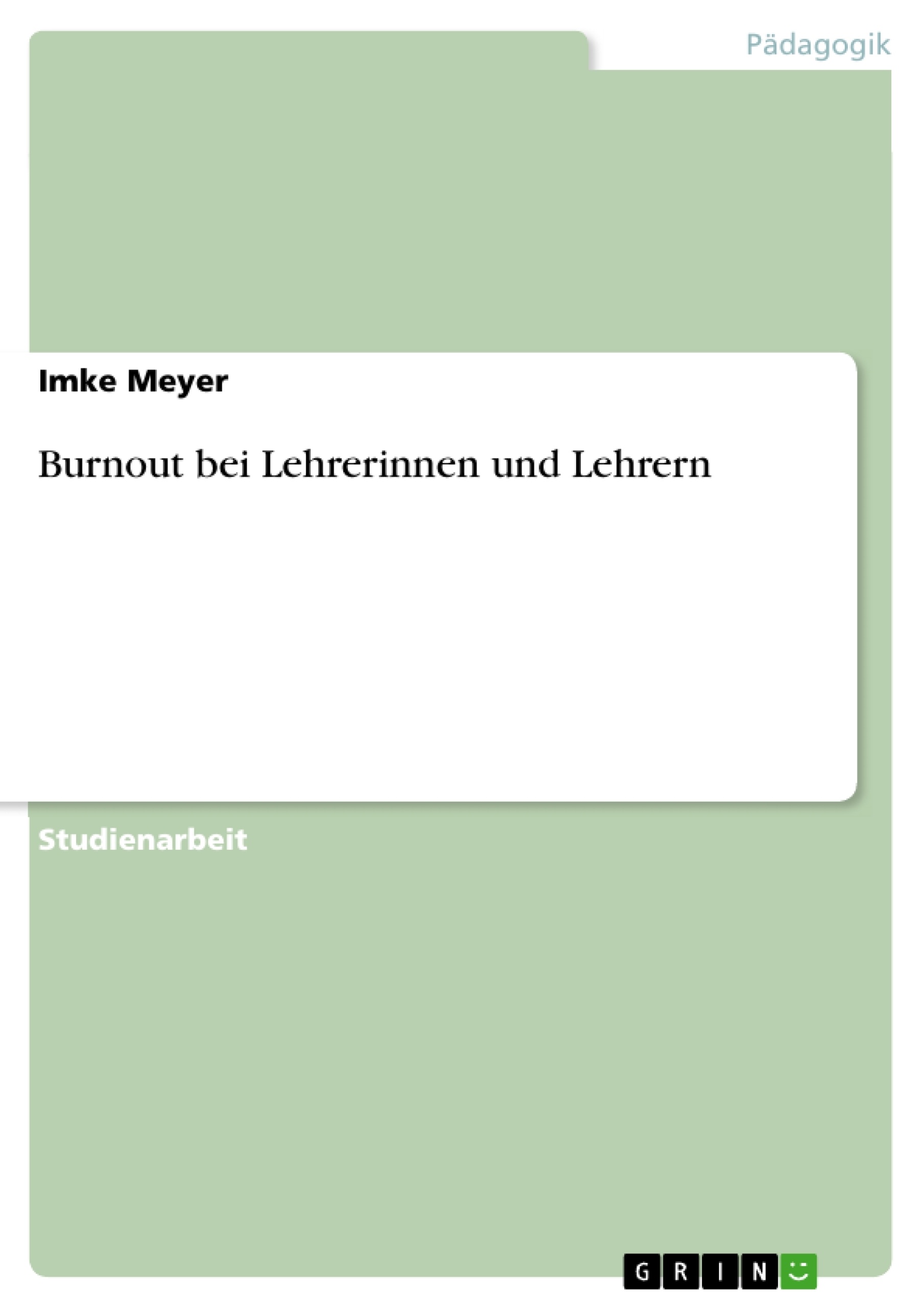„Wer je ein ausgebranntes Gebäude gesehen hat, der weiß, wie verheerend so et-was aussieht.“ Mit diesen Worten beginnt der Vater des Burnout-Begriffs, Herbert Freudenberger, sein 1980 zusammen mit Geraldine Richelson publiziertes Werk Ausgebrannt. Sein Vergleich zwischen einem ausgebrannten Gebäude und einem „ausgebrannten“ Menschen beschreibt das Phänomen Burnout sehr anschaulich: Danach kann der Kraftaufwand, den das Leben in einer komplexen Welt erfordert, die inneren Reserven eines Menschen – dem Feuer gleich – verzehren. Selbst wenn die äußere Hülle mehr oder weniger unversehrt erscheint, bleibt im Inneren eine große Leere zurück. (zum gesamten Absatz vgl. Freudenberger/Richelson 1980)
Inhaltsverzeichnis
1. Ursprung/Definition des Burnout-Begriffs
2. Modelle zur Entstehung von Burnout
2.1 Verschiedenen Phasentheorien
2.2 Die drei Phasen nach Maslach
3. Messinstrumente: MBI-D , BOT
4. Bedingungen bzw. Ursachen von Burnout im Lehrerberuf
5. Folgen von Burnout für die Unterrichtsqualität
6. Prävention (AVEM) und Intervention (AVEM)
7. Kritische Abschlussbemerkung
8. Literaturverzeichnis