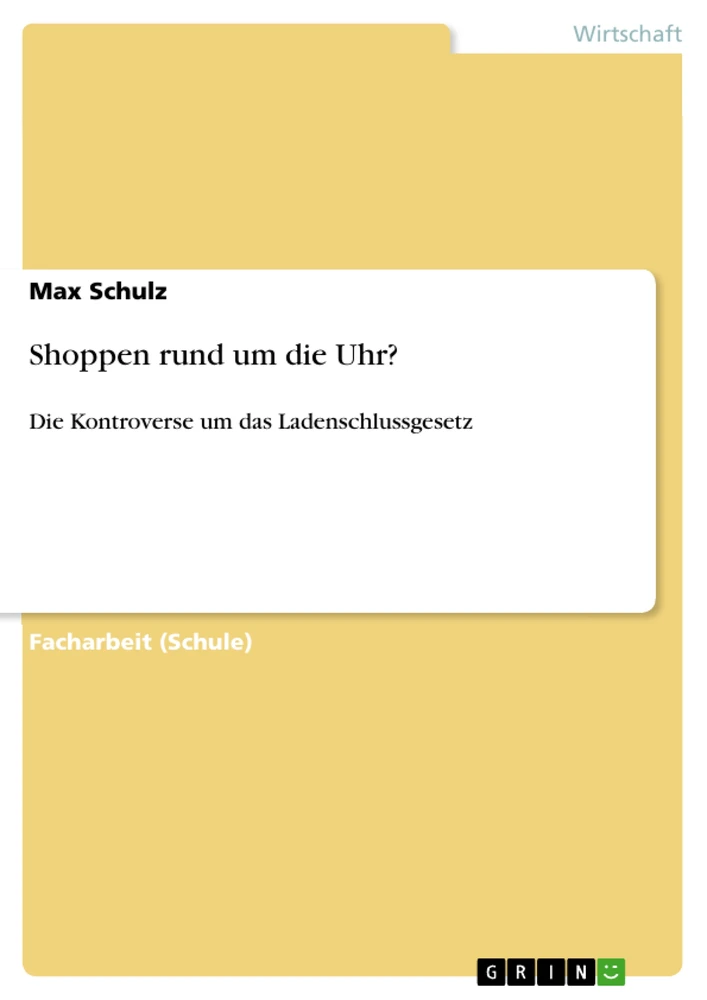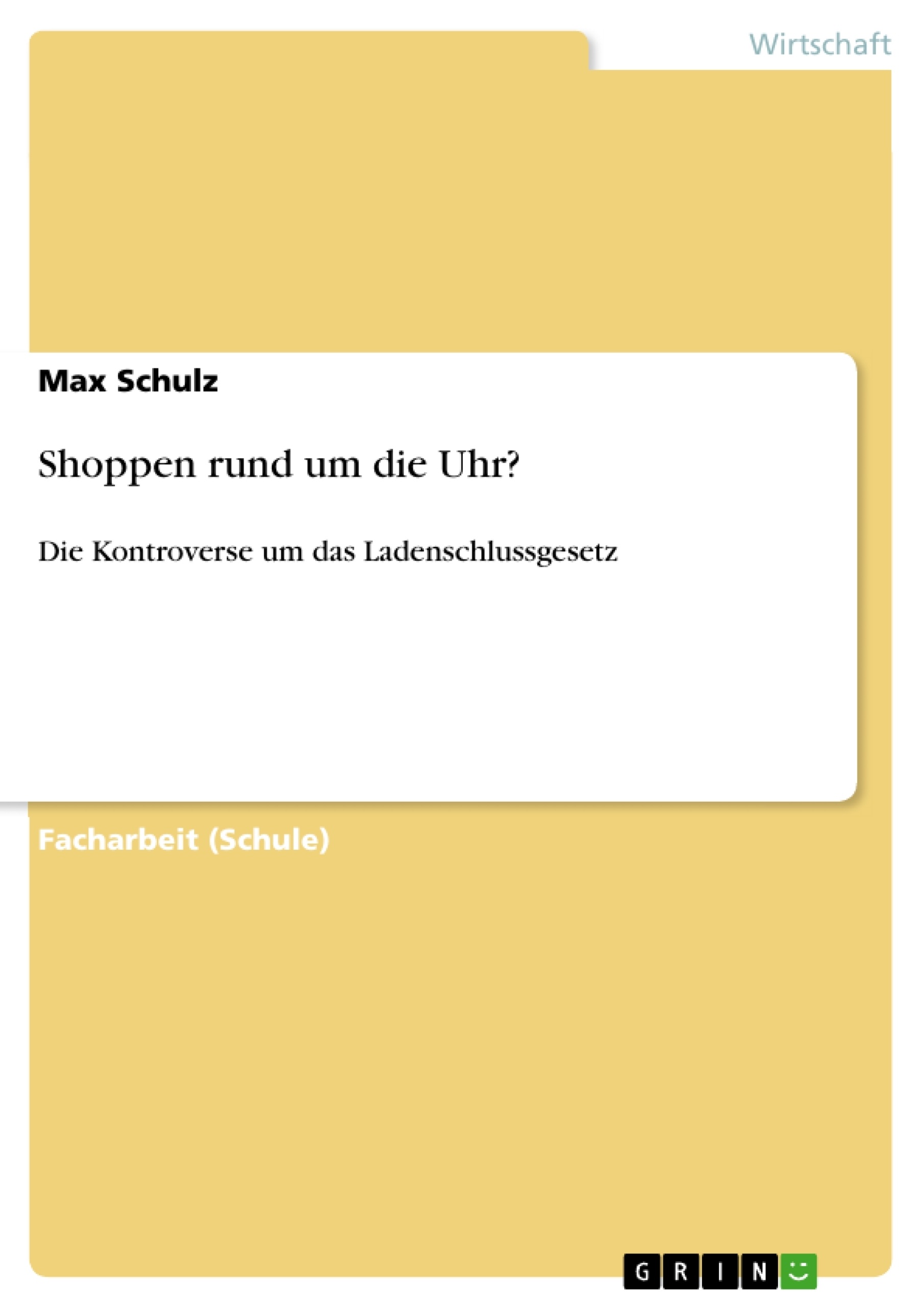„Das Gesetz über den Ladenschluss (…) hat das Ziel, die Beschäftigten im
Einzelhandel vor überlangen Arbeitszeiten und Tätigkeiten zu sozial ungünstigen
Zeiten zu schützen.“ Bereits immer häufiger erkennt man allerdings den Trend zur
durchgehenden Ladenöffnungszeit. Während es zu Beginn des Inkrafttretens des
Ladenschlussgesetzes stets strikte, für alle Bundesländer gleich geltende Regeln über
die Verkaufszeiten gab, änderten diese sich im Laufe der Jahre immer häufiger und
die Liberalisierung des Gesetzes trat zunehmend in den Vordergrund.
In das Visier der Kirche gelangen zahlreiche verkaufsoffene Sonntage, die den Erwerbstätigen
eigentlich zur Entspannung dienen sollen. „Die Argumentationen eines Für und Wider haben sich im Laufe der Jahre nicht wesentlich verändert, dafür aber deren Gewichtung im Zuge des gesellschaftlichen Wandels.“
In der folgenden Facharbeit werde ich genauer auf die Problematik des
Ladenschlussgesetzes und die Veränderungen von Ladenöffnungszeiten sowie die
unterschiedlichen Auswirkungen, die Vor- und Nachteile und die damit verbundenen
Probleme seitens der Verbraucher, Arbeitgeber und der Beschäftigten im
Einzelhandel eingehen.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Entwicklung der gesetzlichen Ladenschlussregelungen in Deutschland
2.1. Begriffsdefinition und Historie des Ladenschlussgesetzes
2.2. Ausnahmeregelung zur Fußballweltmeisterschaft 2006
2.3. Änderungen imRahmender Föderalismusreform2006
3. Ladenschlussregelungenim Vergleich
3.1. Bundesländer Deutschlands
3.2. Europäische Staaten
4. Befürchtungen und auftretende Veränderungen durch die Liberalisierung der Ladenöffnungszeiten
4.1. Befürwortung
4.1.1. Verbraucher
4.1.2. Arbeitgeber im Einzelhandel
4.2. Ablehnung
4.2.1. BeschäftigteimEinzelhandel
4.2.2. ChristlicheKirchen inDeutschland
5. Fazit
Literaturverzeichnis