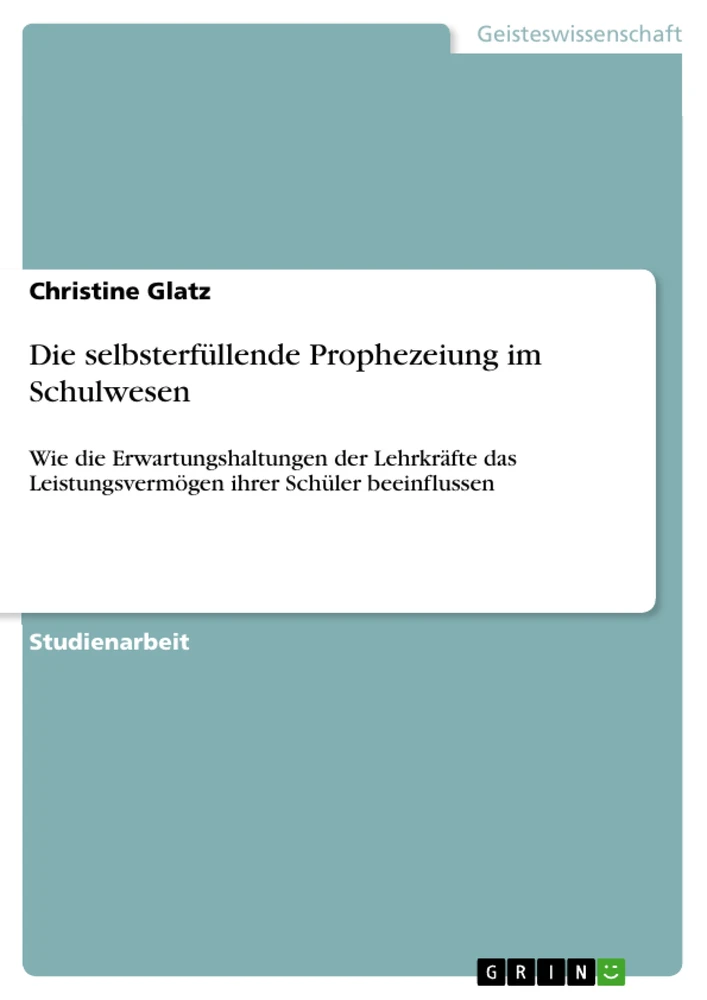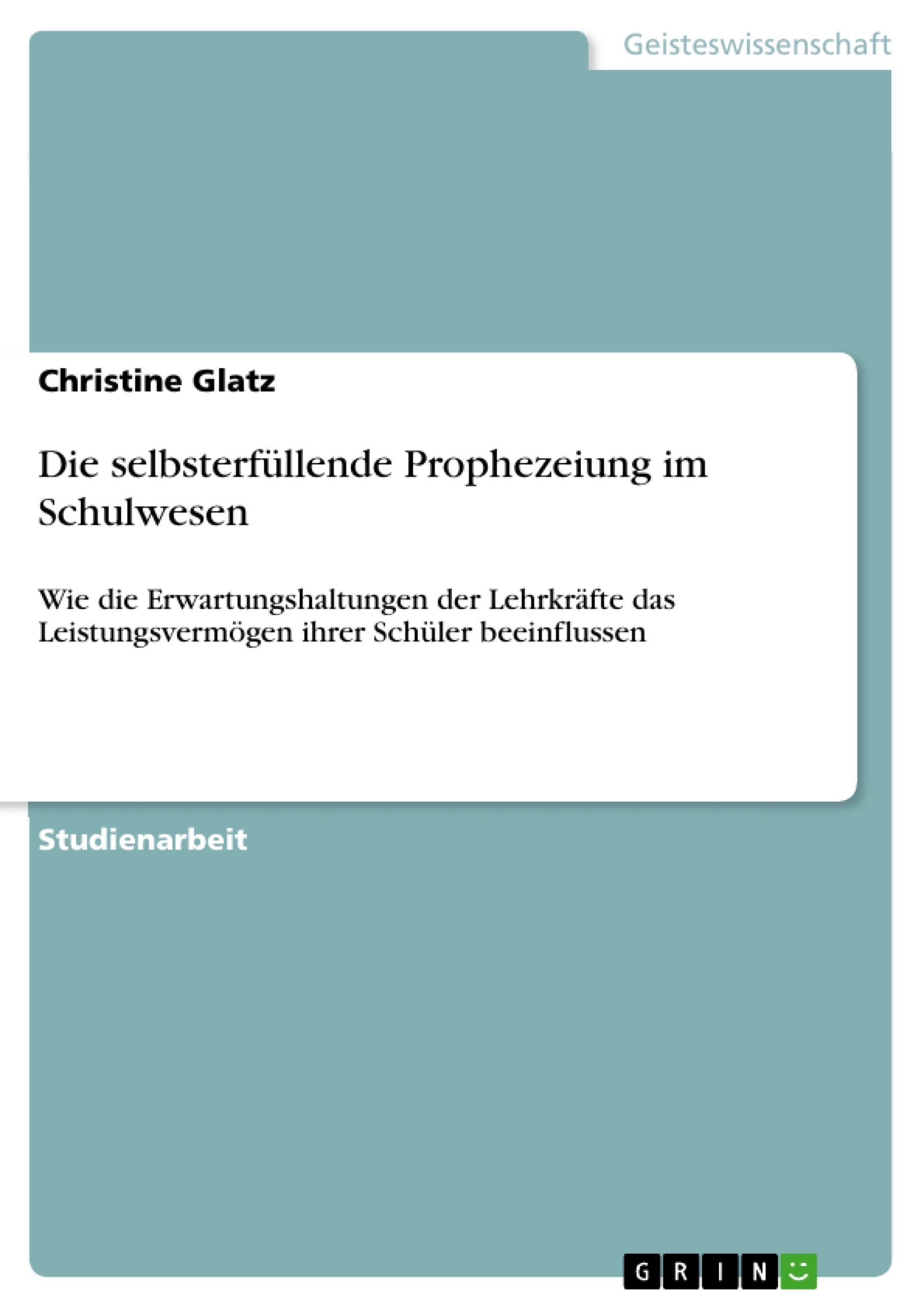Obwohl die Diskussion um die Effekte der sogenannten selbsterfüllenden Prophezeiung
bereits seit Jahrzehnten die empirische Wissenschaft beschäftigt, ist sie dennoch aktuell und
bietet zahlreiche Forschungsfragen, die bislang nicht eindeutig geklärt werden konnten.
Während erste Studien zu den Auswirkungen von Lehrererwartungen auf Schülerleistungen
noch scheinbar skandalöse Ergebnisse hervorbrachten und die Diskussion entfachten, ob
Lehrkräfte somit maßgeblich für das Zustandekommen von schulischen und folglich sozialen
Ungleichheiten verantwortlich seien, konnten zahlreiche spätere Studien zeigen, dass eine
derart vereinfachte Sichtweise nicht ausreichend ist, um das weite Feld dieses Themas
angemessen darzustellen.
In der folgenden Arbeit soll nun aufgedeckt werden, was die Forschung bisher zeigen konnte
und welche Aspekte weiterhin Fragen aufwerfen.
Inhalt
1 Einleitung
2 Die selbsterfüllende Prophezeiung im Schulkontext
2.1 Allgemeines
2.2 Bisherige Forschung
2.3 Grenzen der selbsterfüllenden Prophezeiung
3 „Do Self-Fulfilling Prophecies Accumulate, Dissipate, or Remain Stable Over Time?“ (Eccles, Jussim & Smith, 1999) – eine Studie im Überblick
3.1 Hypothesen
3.2 Methode
3.3 Ergebnisse
3.4 Bewertung und Implikationen
4 Fazit
5 Literatur