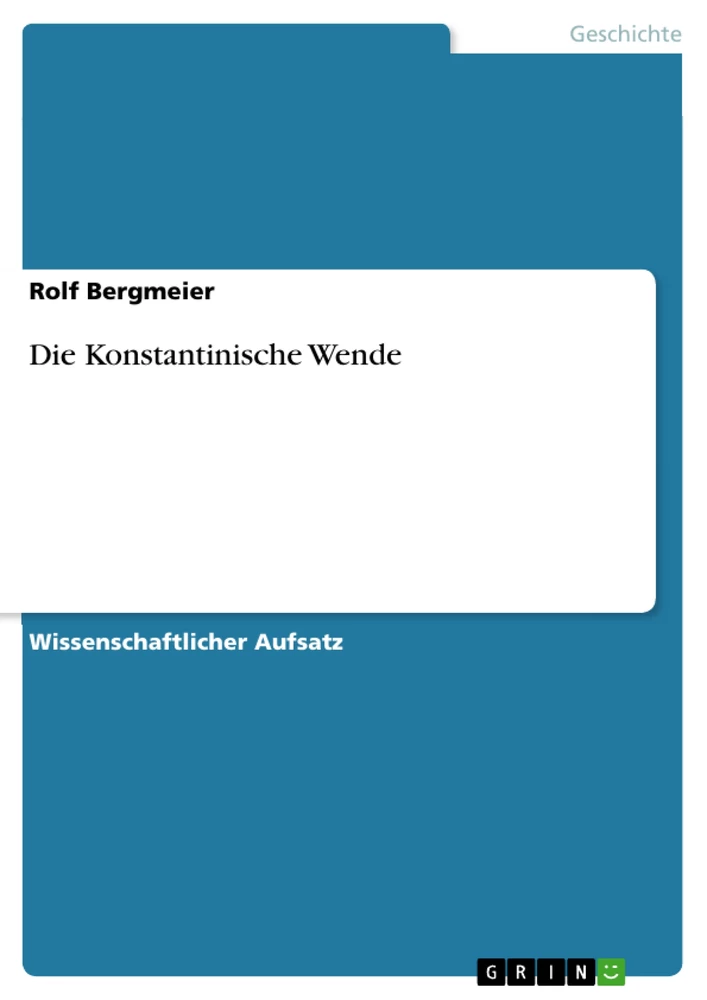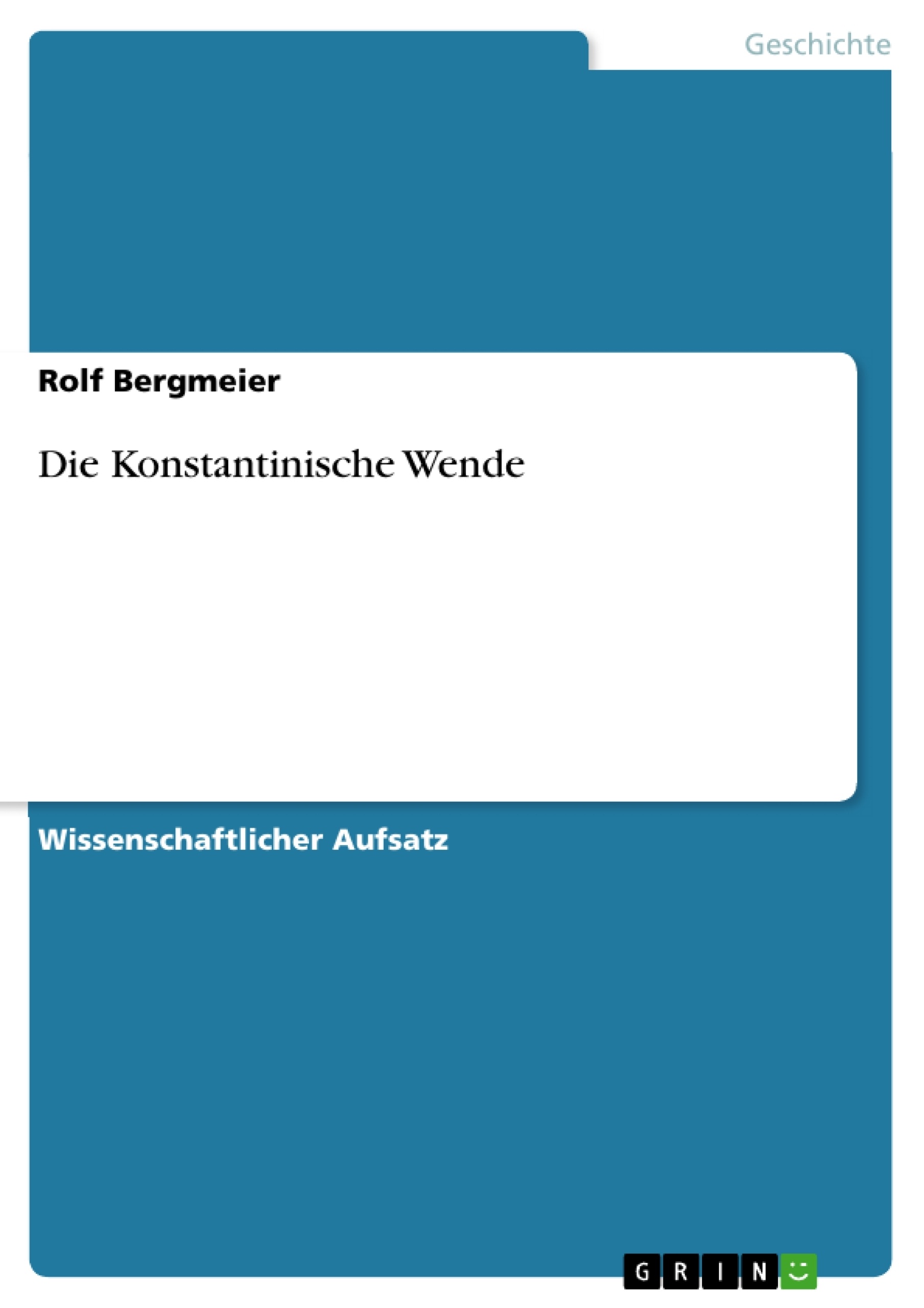"Konstantinische Wende". Sie hat sich in der gesamten theologischen und spätantiken Literatur umfassend und weitgehend unbezweifelt eingenistet. Sie sei "das einschneidende Ereignis der antiken Religionsgeschichte", meint der Düsseldorfer Althistoriker B. BLECKMANN. Andere Autoren sekundieren: Mit Konstantin habe "ein geschichtlicher Wendepunkt ersten Ranges", "eine welthistorische Weichenstellung", eine „epochemachende geistige Revolution“ begonnen. E. SCHWARTZ vermeint sogar, den „dämonischen Scharfblick des Weltbezwingers“ und eine "Zeitenwende ungeheuren Ausmaßes" zu erkennen, „jäh und plötzlich [habe Konstantin] dem Steuerrad der Geschichte in die Speichen“ gegriffen . Der Historiker EHRHARD erkennt den "Anbruch einer neuen Zeit", sogar "frei von Schmerz und Trauer" soll diese neue Zeit gewesen sein . A. ALFÖLDI spricht vom "Glück der Menschheit" und der französische Althistoriker P. VEYNE kann seine überschäumende Wende-Begeisterung kaum zügeln: Die historische Bedeutung Konstantins sei „gigantisch“, seine Wendung zum Christentum „das entscheidende Ereignis [...] der Weltgeschichte“ . Der historisch-literarische Begeisterungstaumel ist also ein allgemeiner.
Dabei gibt es durchaus Anlaß, an einer „Wende“ Konstantins zum Christentum im Oktober 312 zu zweifeln. Nicht nur, weil er seine eigene Familie in einem barbarischen Akt auslöscht, nicht nur weil er sein Volk mit einem zwölfjährigen Krieg überzieht, um die Alleinherrschaft zu erringen, sondern auch weil der Herrscher eine Fülle von Signalen aussendet, mit denen er zu verstehen gibt, dass andere Götter und nicht Christus seine Lieblingsgefährten sind.
Der wichtigtste Einwand jedoch kommt unerwartet: Das uralte Kreuzsymbol und das Sternsymbol mit Halbdiskus, später zum "Christogramm" avanciert, sind zur Zeit Konstantins noch keine christlichen Symbole.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Konstantins Marsch auf Rom und die Nacht der "Wende" (312)
2.1 Träume, Visionen und Symbole vor der großen Schlacht
2.1.1 Laktanz und das Christus-Monogramm
2.1.2 Eusebius und die Kreuzlegende
2.2 Die Meinung der Symbolforschung
2.2.1 Das Christogramm
2.2.2 Das Kreuz-Symbol
2.3 Ergebnis
3 Konstantinische Wende ?
4 Bibliographie
4.1 Antike Quellen und Textausgaben
4.2 Kompendien und Nachschlagewerke
4.3 Literatur