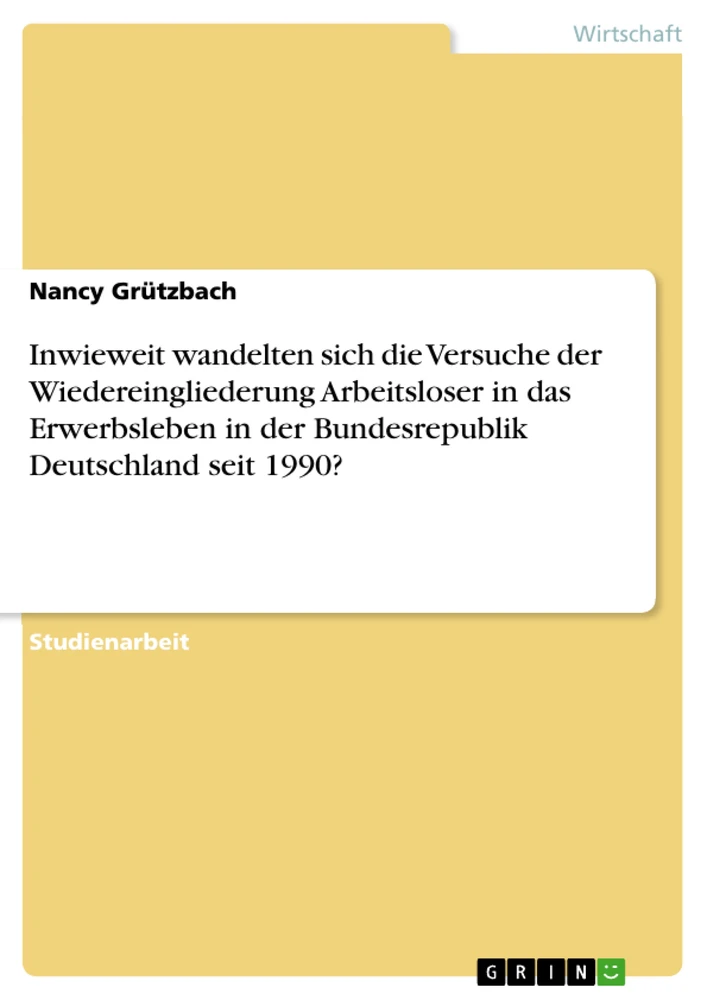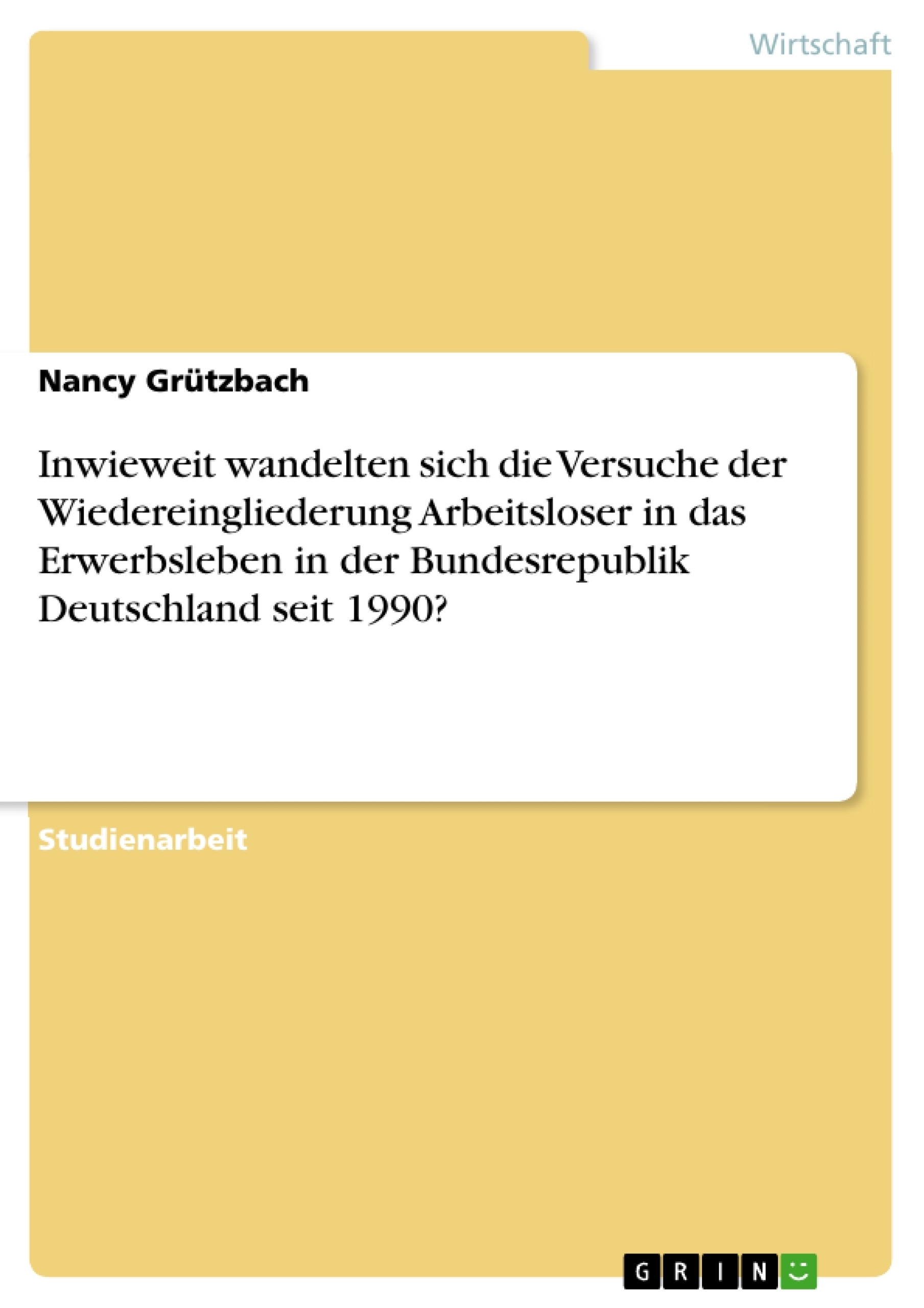Deutschland gehört im internationalen Vergleich zu den reichsten Ländern der Erde. Dem entgegen stehen die Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt. Es zeigt sich, dass die Dynamik und Wohlstand-steigerung keinen Beschäftigungswachstum mit sich bringt (vgl. Boeck/
Huster/ Benz 2006: 213). Die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und ihre ökonomischen und gesellschaftlichen Folgen, stellt daher eine wichtige Aufgabe der Politik dar und ist ein, in der Bundesrepublik Deutschland, viel debattiertes Thema. Erwerbslosigkeit belastet zum einen jene, die keine Beschäftigung haben, zum anderen ergeben sich gesamtwirtschaftliche Folgen (vgl. Gerster 2003: 9).
Neben den passiven Leistungen im Rahmen der Arbeitsmarktpolitik, welche der Einkommenssicherheit während der Arbeitslosigkeit dienen, zielen die aktiven Leistungen auf die Überwindung der Arbeitslosigkeit ab (vgl. Boeckh/ Huster/ Benz 2006: 224f.).
Die Versuche der Wiedereingliederung von Arbeitslosen, das heißt die aktiven Leistungen, stellen insoweit einen wichtigen Pfeiler in der deutschen Sozialpolitik dar, als dass die Arbeitslosigkeit die Finanzierung des Staates gefährdet. Es ergeben sich Einnahmeausfälle in den Sozialversicherungssystemen und öffentlichen Haushalten, steigende Sozialbeiträge, wachsende Lohnnebenkosten und somit eine negative wirtschaftliche Entwicklung (vgl. Pilz 2004: 132). Die Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik muss deshalb für die Wiedereingliederung der Arbeitslosen Sorge treffen.
Diese Arbeit soll sich demnach mit der Frage befassen, inwieweit sich die Versuche der Wiedereingliederung Arbeitsloser seit 1990 gewandelt haben. Den Abschluss der Betrachtungen wird die Einführung des SGB II im Jahr 2005 bilden, da dies die letzte große
Gesetzesänderung innerhalb der Arbeitsmarktpolitik darstellt.
Zunächst werde ich kurz die Ursachen der Arbeitslosigkeit, die Zielsetzungen der Arbeitsmarktpolitik und die Ursprünge des Fürsorgesystems der Bundesrepublik Deutschland darlegen. Im Anschluss daran gehe ich auf Neuorientierung der Arbeitsmarkt- und
Sozialpolitik in den 1990er Jahren ein. Es folgt die Darstellung der Veränderungen, die die Einführung des SGB III und schließlich die „Hartz-Kommission“ mit sich brachten, und abschließend die Beantwortung der Frage, inwieweit sich der Versuch der
Wiedereingliederung Arbeitsloser seit 1990 geändert hat.
[...]
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Ursachen der Arbeitslosigkeit
3. Ziele der Arbeitsmarktpolitik
4. Ein historischer Umriss des deutschen Fürsorgesystems
5. Arbeitsmarkt- und sozialpolitische Neuorientierung in den 1990er Jahren
6. Die Einführung des SGB III
7. Wandel auf institutioneller Ebene
8. Die Arbeitsvermittlung durch Bewerberprofile
9. Die „Hartz-Kommission“ & ihre Ergebnisse
9.1. „Hartz I“
9.2. „Hartz II“
9.3. „Hartz III“
9.4. „Hartz IV“- die Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe
9.4.1. Aktivierung und Betreuung im Zuge der Einführung des SGB II
9.4.2. Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung
9.4.3. Kritik gegen die Maßnahmen der „Hartz-Gesetze“
9.4.4. Anreiz zur Arbeitsaufnahme durch Sanktionen?
10. Fazi
Abkürzungsverzeichnis
Quellen- und Literaturverzeichnis