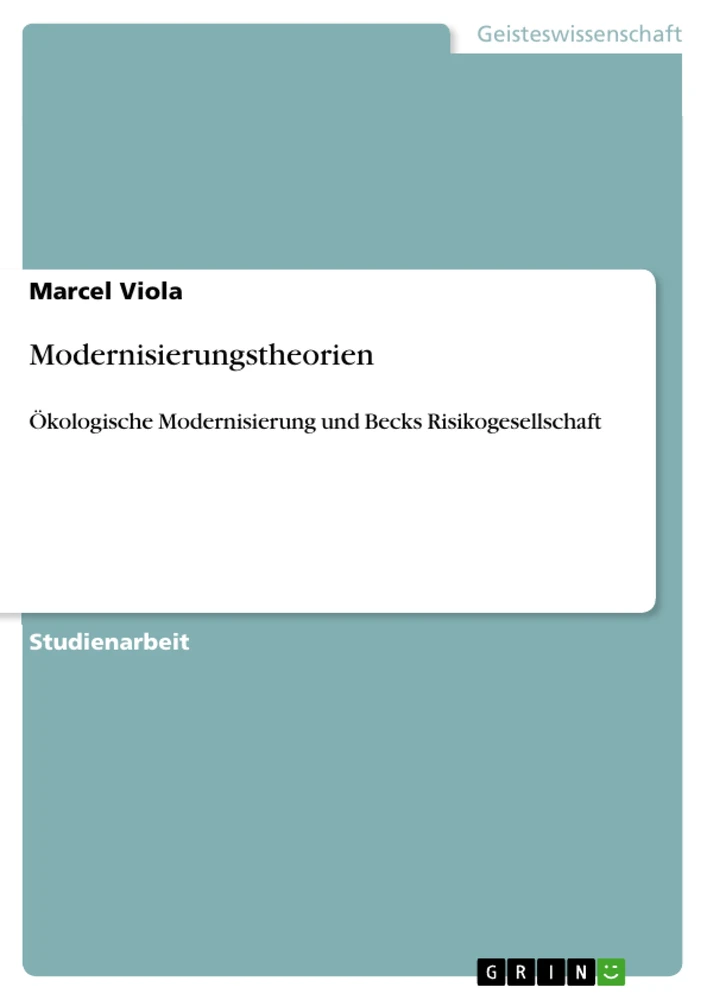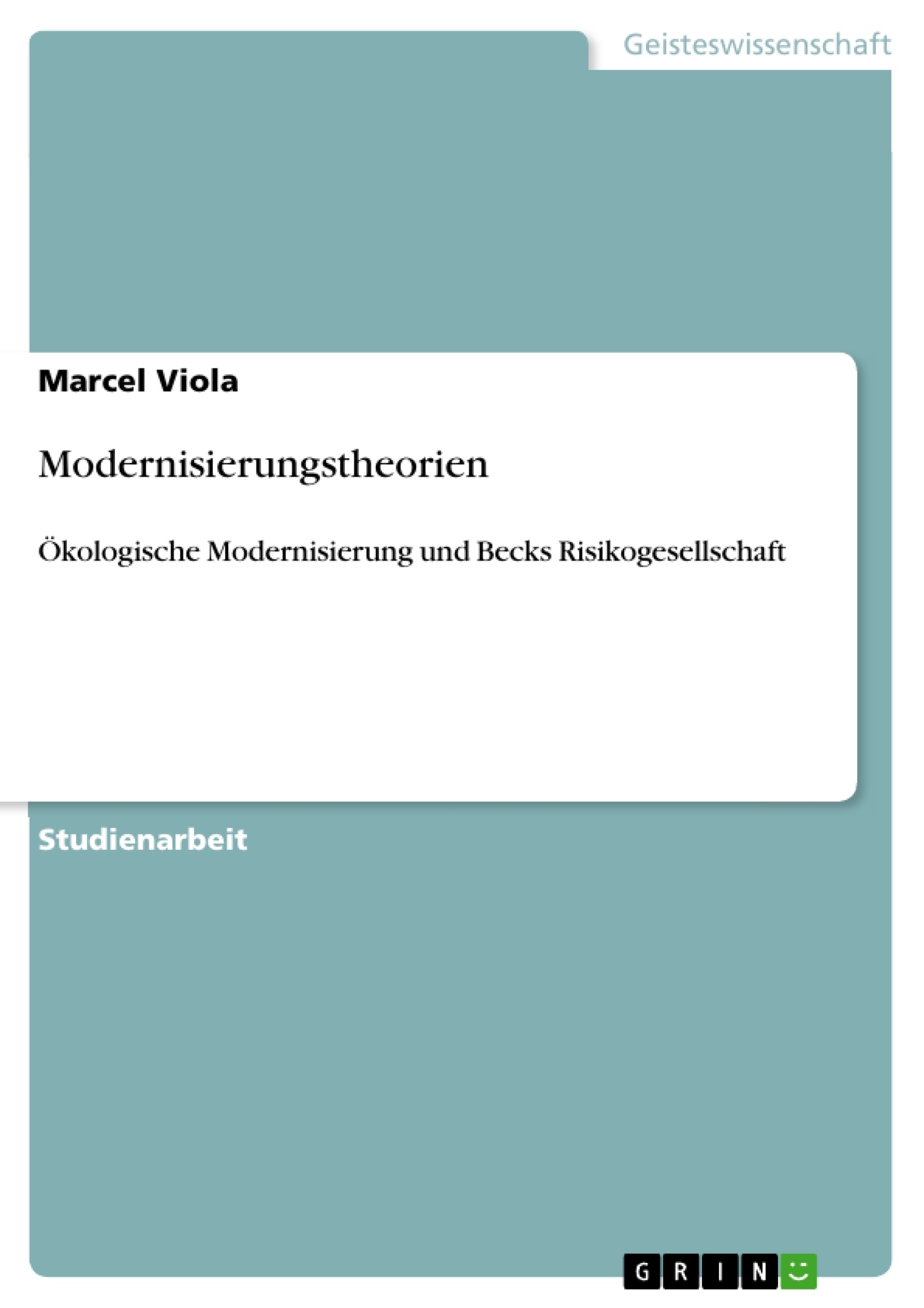Was zeichnet eine, in diesem Fall unsere, moderne Gesellschaft aus? Würde man diese Frage weiten Teilen der Gesellschaft stellen, erhielte man wahrscheinlich Antworten wie Ethik, Moral, technologische Errungenschaften, Demokratie und inzwischen auch ein gestiegenes Umweltbewusstsein. Diese Antworten zielen freilich auf die moderne und hochtechnologische Zivilisation westlicher Prägung ab. Aber auch andere Gesellschaften befinden sich im Wandel oder Umbruch. Es zeichnen sich neue global Player wie China und Indien am Horizont ab und werden beziehungsweise haben schon mit denselben Problemen zu kämpfen, wie sie in Europa und Amerika bereits stattfanden und natürlich noch andauern. Wie aber kann eine moderne Gesellschaft und deren Geschichte noch bewertet werden? Die Risikoeinschätzung spielt eine immer größere Rolle, auch bei der Zukunftsfähigkeit der etablierten Gesellschaftsstrukturen. Hochtechnologie in den Bereichen Energiebeschaffung, Medizin, Umwelt oder Militär stabilisiert und fördert nicht nur, sie bringt auch vielfältige Risiken mit sich die zum Teil noch nicht überschaut oder in ihrem vollem Umfang bewertet werden können.
Im Rahmen dieser Hausarbeit zu dem Fachbereich Umweltsoziologie, werde ich mich mit den Modernisierungstheorien von Joseph Huber der „ökologischen Modernisierung“ und Ulrich Becks bekannter „(Welt)Risikogesellschaft“ beschäftigen. Sie stellt damit eine schriftliche Ausarbeitung meines Referates dar, in dem ich mich bereits mit diesem Thema befasst habe.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Modernisierungstheorien
3. ökologische Modernisierung
3.1. ökologische Modernisierung und ihre Ziele
3.2. Gesellschaftswandel
3.3. Entwicklungsmodell ökologischer Modernisierung
4. Becks (Welt) Risikogesellschaft
4.1. Merkmale der Risiken
4.2. Bumerang und Politik von Unten
4.3. Weltrisikogesellschaft
5. Diskussion
Literaturverzeichnis