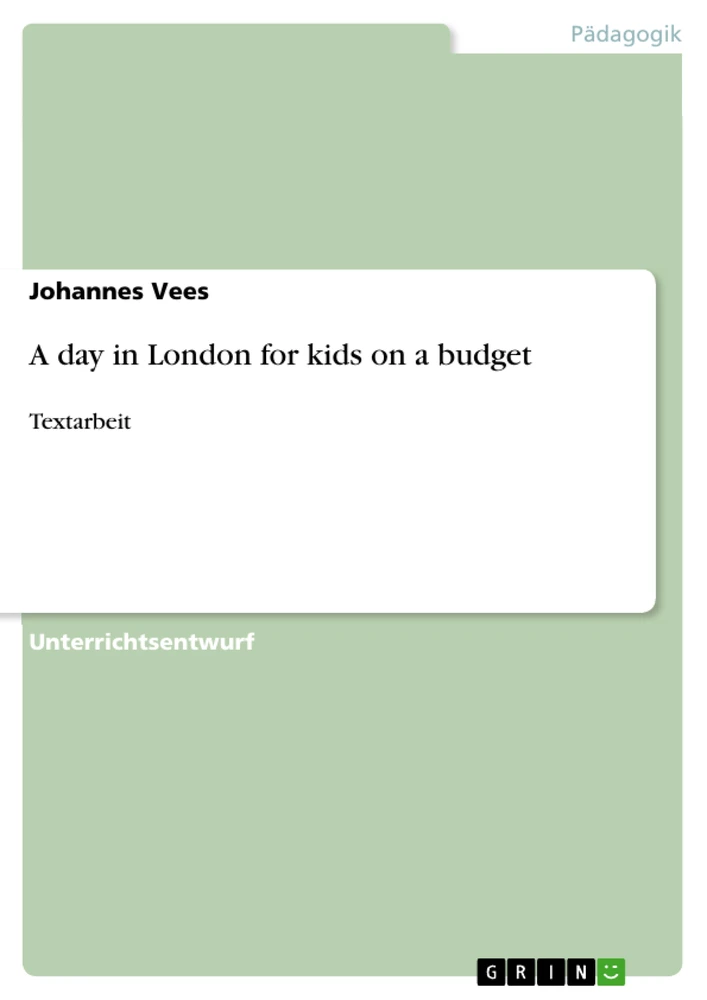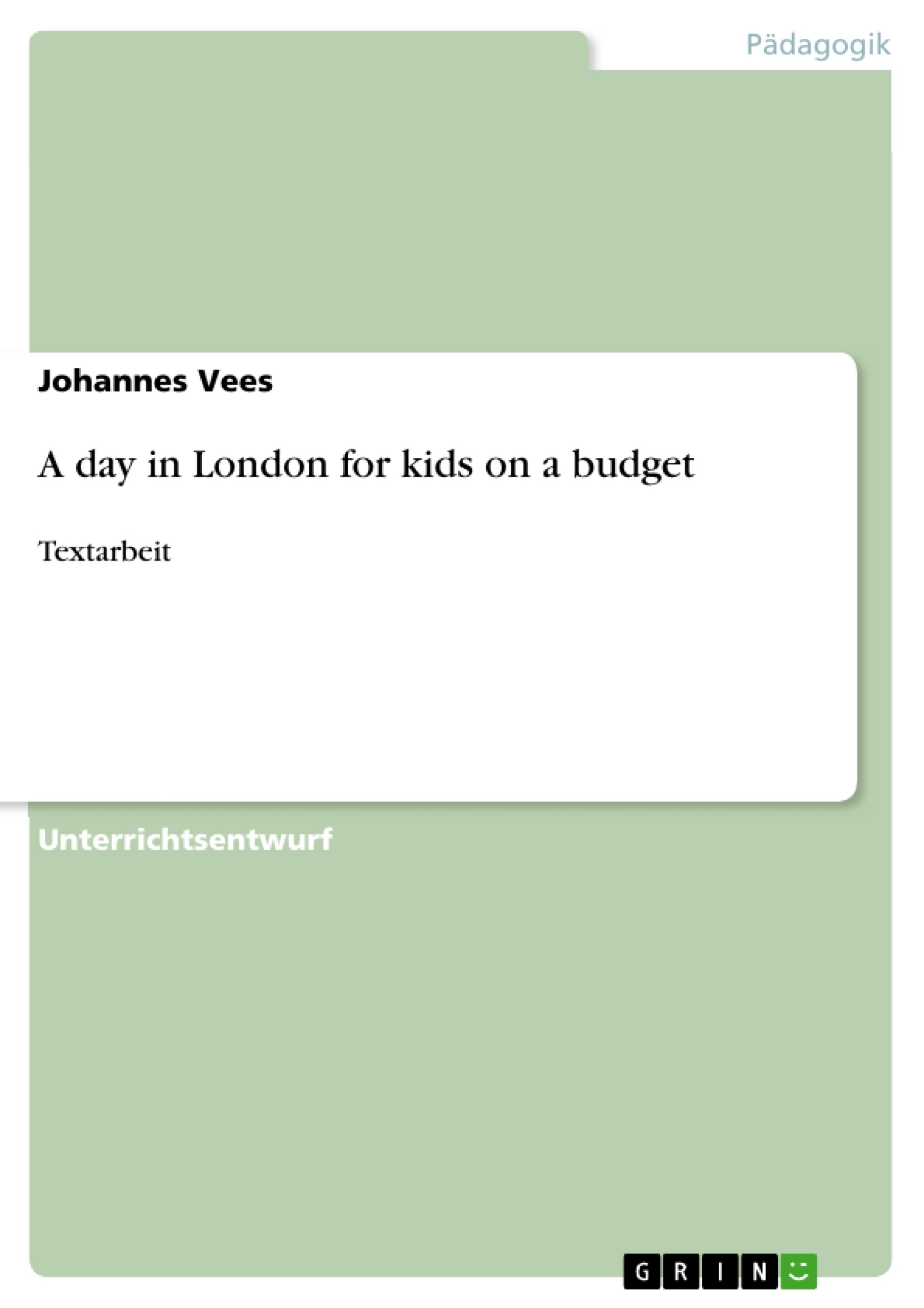Ausführlicher Unterrichtsentwurf im Rahmen eines Unterrichtsbesuchs des Lehrbeauftragten vom Staatlichen Seminar für Didaktik und Lehrerbildung. Die Stunde wurde in der 7. Klasse einer Realschule gehalten. Sie verlief reibungslos und wurde positiv bewertet.
Die Zeitform „present perfect“ wird im Englischen für solche Handlungen verwendet, bei welchen das Resultat in der Gegenwart von Bedeutung ist (Bsp.: I have cleaned my room Now it’s tidy). Bei dieser sogenannten resultativen Verwendung der Zeitform ist der Vorgang zwar bereits abgeschlossen, jedoch wird das Ergebnis in der Gegenwart betont („present perfect simple“). Es wird darüber hinaus für soeben abgeschlossene Handlungen (Bsp.: I have just played tennis) und bis in die Gegenwart hineinreichende Vorgänge (Bsp.: The match has not started yet) benutzt. Demgegenüber steht die kontinuative Verwendung, bei welcher die bisherige Dauer eines in der Vergangenheit begonnenen und bis in die Gegenwart hineinreichenden Zustands im Vordergrund steht. Bei Verben mit dynamischer Bedeutung wird das „present perfect progressive“ verwendet (Bsp.: She has been singing), das in der zu haltenden Englischstunde allerdings unberücksichtigt bleiben wird.
Inhaltsverzeichnis
1. Bedingungsanalyse
1.1 Institutionelle Voraussetzungen
1.2 Anthropogene Voraussetzungen
1.3 Situation des Anwärters in der Klasse
2. Sachanalyse
3. Didaktische Analyse
3.1 Bezug zum Bildungsplan
3.2 Bedeutung für die Schüler
3.3 Das Stundenthema innerhalb der Unterrichtseinheit
4. Lernziele
4.1 Übergeordnetes Stundenziel
4.2 Fachliche Ziele
4.3 Methodische Ziele
4.4 Soziale, personale, affektive Ziele
5. Verlauf der Stunde (Methodische Entscheidungen, Differenzierungen, Alternativen)
6. Medien
7. Literaturverzeichnis und weitere Quellenangaben
8. Anhang