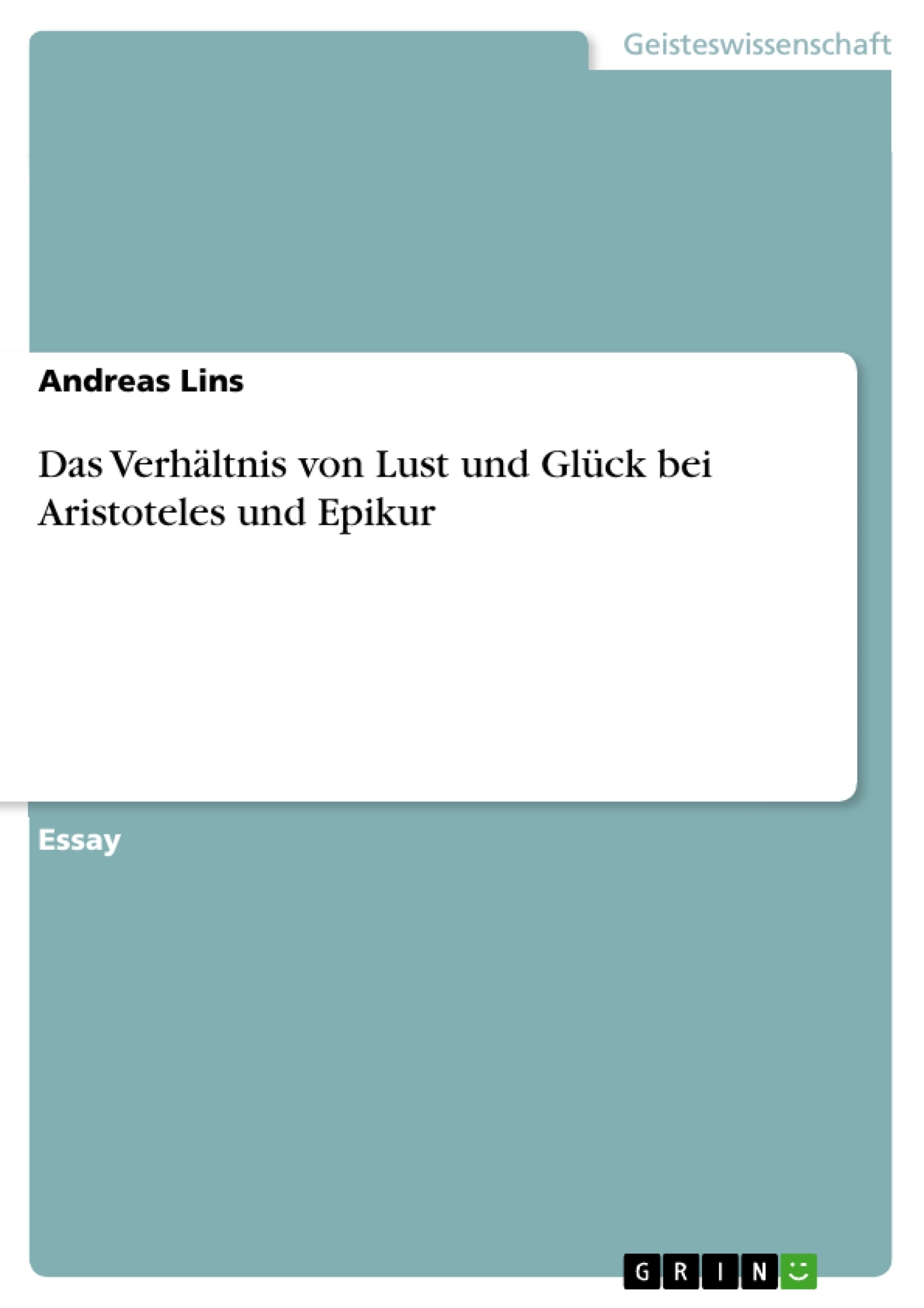In diesem Essay wird ein Vergleich zwischen dem Verhältnis von Glück und Lust bei
Aristoteles und Epikur angestellt. Zentrale Frage ist dabei, was das Glück ist, wie man es
erreichen kann und welche Rolle die Lust bei diesen Überlegungen einnimmt.
Aristoteles (384 ‐ 322 v.Chr.) und Epikur (341 ‐ 271/270 v.Chr.) trennt eine Generation.
Während Aristoteles vor allem von seinem Lehrer Platon inspiriert war, ist Epikur in seinen
philosophischen Überlegungen sehr von der aufkommenden Stoa und seiner oppositionellen
Haltung gegenüber dieser Denkschule geprägt.
Die Parallelen der beiden Autoren werden im Laufe der Untersuchung unverkennbar sein,
doch gerade die Bewertung der Lust macht die Unterschiede zwischen den beiden Ethiken
sehr deutlich. Im zweiten Kapitel wird zuerst der Glücksbegriff erklärt und sprachlich abgegrenzt, wie er in
der griechischen Philosophie, am Beispiel des Aristoteles, verwendet wird.
Das dritte Kapitel verbindet die vorhergehenden Erkenntnisse zuerst mit dem Lustbegriff bei
Aristoteles und im zweiten Teil mit der zentralen Rolle der Lust in Epikurs hedonistischer
Ethik.
Im vierten Kapitel werden die Erkenntnisse zusammengefasst und der Vergleich mit einem
Fazit abgeschlossen.
Das Verhältnis von Lust und Glück bei Aristoteles und Epikur
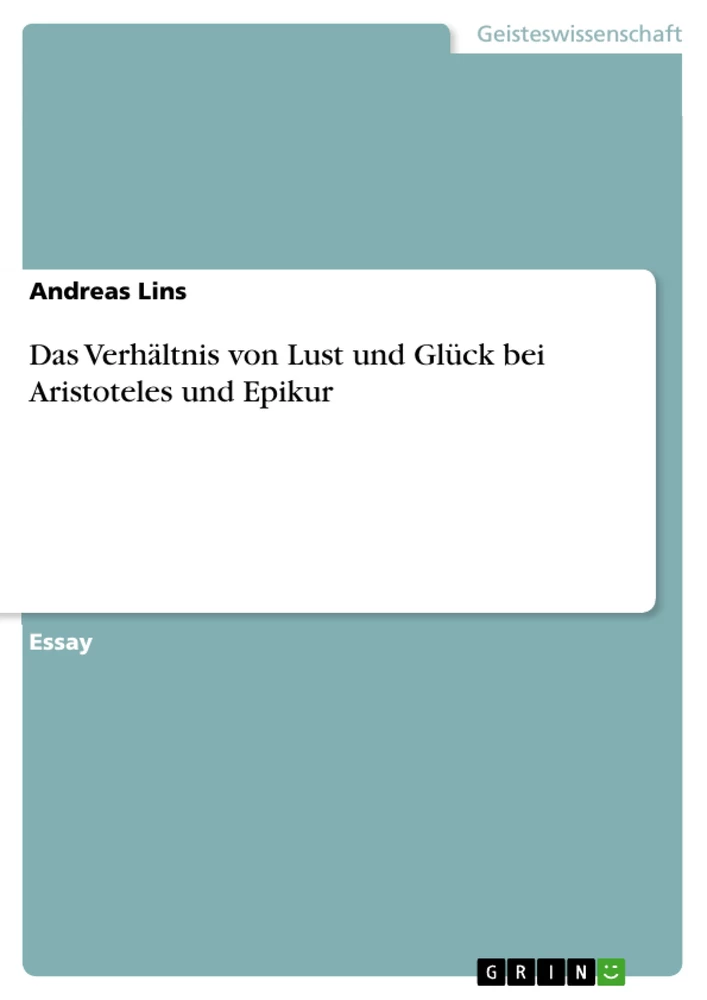
Essay , 2011 , 9 Seiten , Note: 2,0
Autor:in: Andreas Lins (Autor:in)
Philosophie - Praktische (Ethik, Ästhetik, Kultur, Natur, Recht, ...)
Leseprobe & Details Blick ins Buch