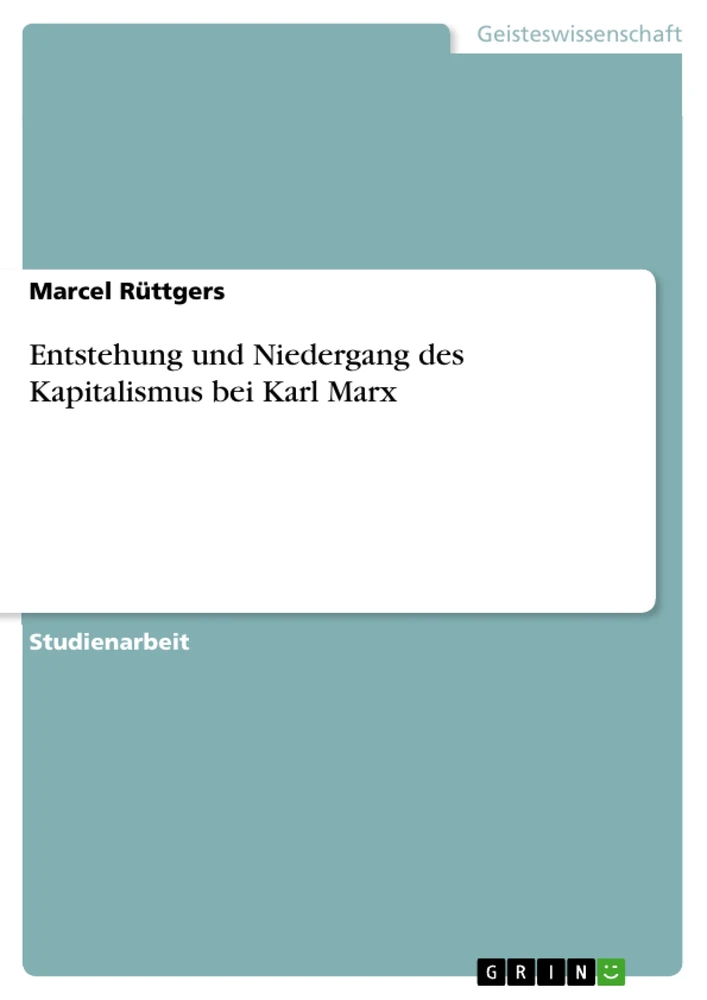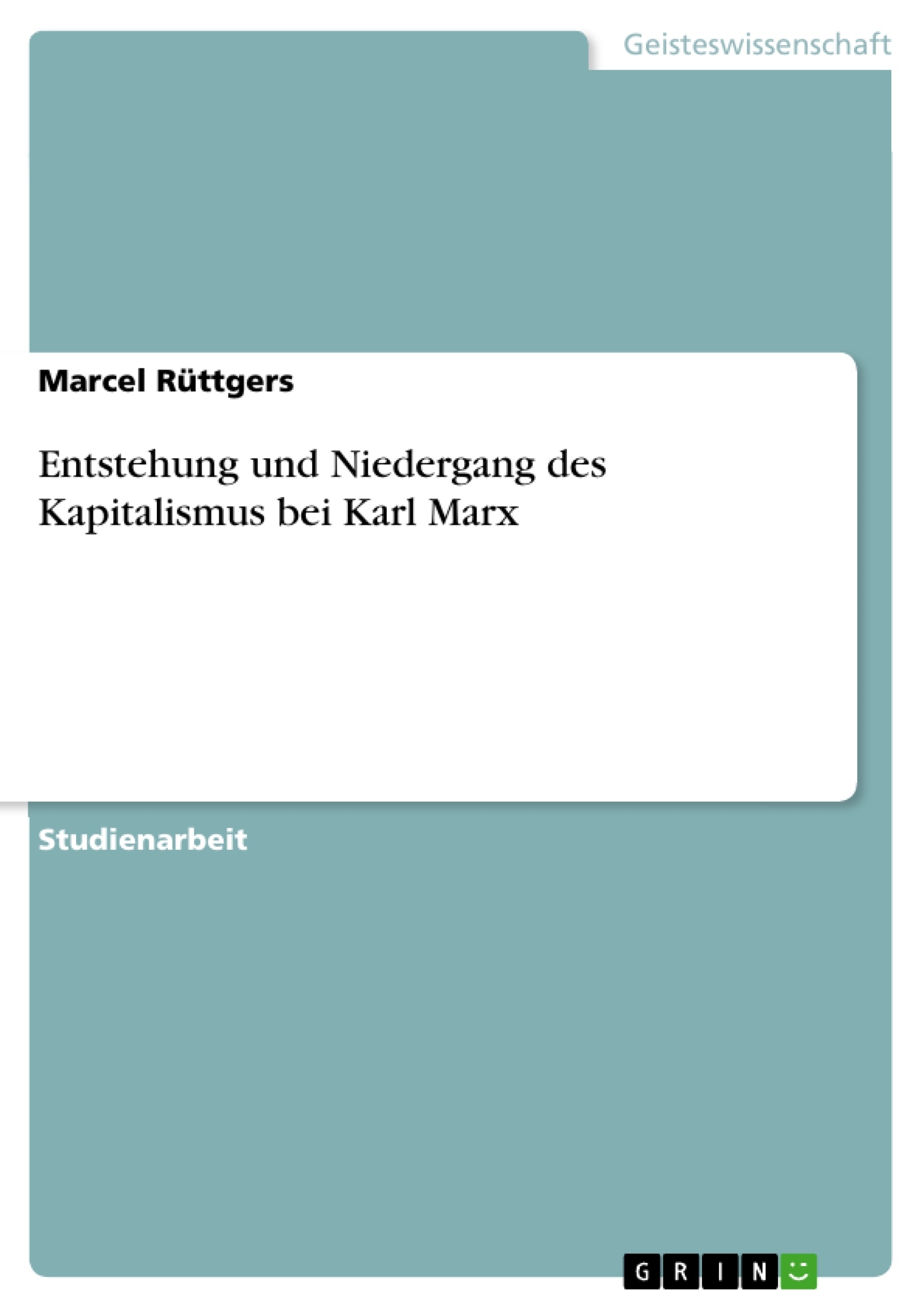Die aktuelle Finanzkrise sorgt dafür, dass eine bisher als unumstößlich geltende Institution heiß diskutiert wird: der Kapitalismus. Vom Versagen der freien Marktwirtschaft, vom Ende einer Epoche ist hier die Rede . Selbst die US-amerikanische Washington Post sieht den „american-style capitalism“ als ein Opfer der größten Finanzkrise seit den 1920er Jahren an. Der britische Guardian dahingegen wundert sich: „How tables turn. Socialism is now cock of the walk, capitalism mugged by reality. It’s rubbish, total rubbish“ . Eins machen diese Zitate aber deutlich: Die Finanzkrise hat weltweit eine Hysterie ausgelöst, teilweise herrscht gar Untergangsstimmung.
Was liegt nun näher als sich in diesem Zusammenhang mit Karl Marx zu beschäftigen? Die vorliegende Arbeit widmet sich der Frage, wie Marx die Entstehung des Kapitalismus beschreibt und welche Gründe er für dessen Untergang gegeben sah. Gleichwohl Marxens kommunistisches Gespenst sicherlich nicht mehr in Europa umhergeht, ist das Thema der Krise des Kapitalismus von enormer Aktualität und obwohl zugestanden werden muss, dass die Marx’schen Ausführungen nicht mehr eins zu eins auf die heutige Situation übertragen werden können, lohnt sich dennoch ein Blick auf seine Beschreibungen und Prognosen.
Um dies angehen zu können, wird zunächst ein allgemeiner Blick auf die materialistische Geschichtsauffassung Marxens geworfen, mit der er die Gesellschaft und ihren Entwicklungsgang entlang ökonomischer Kriterien zu erklären versucht. Im Anschluss daran, wird aufgezeigt, wie der Kapitalismus überhaupt entstehen konnte, welche Voraussetzungen dafür gegeben sein mussten. Die nächsten Kapitel beschäftigen sich sodann mit der Frage nach den Eigenschaften des Kapitalismus. Hier soll aufgezeigt werden, wie sich die beiden Klassen der Bourgeoisie und des Proletariats unterscheiden und welche Merkmale die Situation dieser Klassen prägen. Im Anschluss daran werden die Marx’schen Prognosen zum Untergang des Kapitalismus näher erläutert. Hier muss allerdings auch angemerkt werden, dass es die Zusammenbruchstheorie bei Marx nicht gibt . Vielmehr finden sich an vielen Stellen Beschreibungen über die Krisen des Kapitalismus sowie über die Notwendigkeit und die Voraussetzungen einer kommunistischen Revolution.
Die Analyse wird sich dabei allerdings in erster Linie auf die frühen Werke Marxens konzentrieren. Von zentraler Bedeutung sind hier die ökonomisch-philosophischen Manuskripte von 1844, die deutsche Ideologie (1845)......
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Die Materialistische Geschichtsauffassung
3. Der Übergang vom Feudalismus zum Kapitalismus
4. Bourgeoisie und Proletariat
5. Die Situation des Proletariats
6. Kapitalismus und Kommunismus
7. Krisen und Revolution
8. Fazit