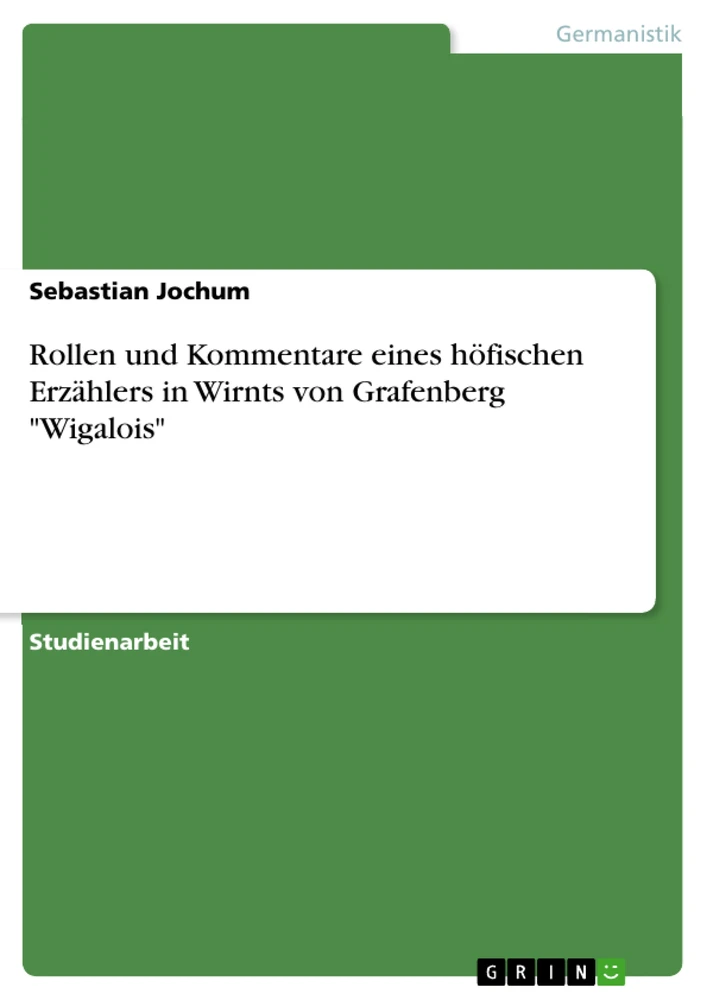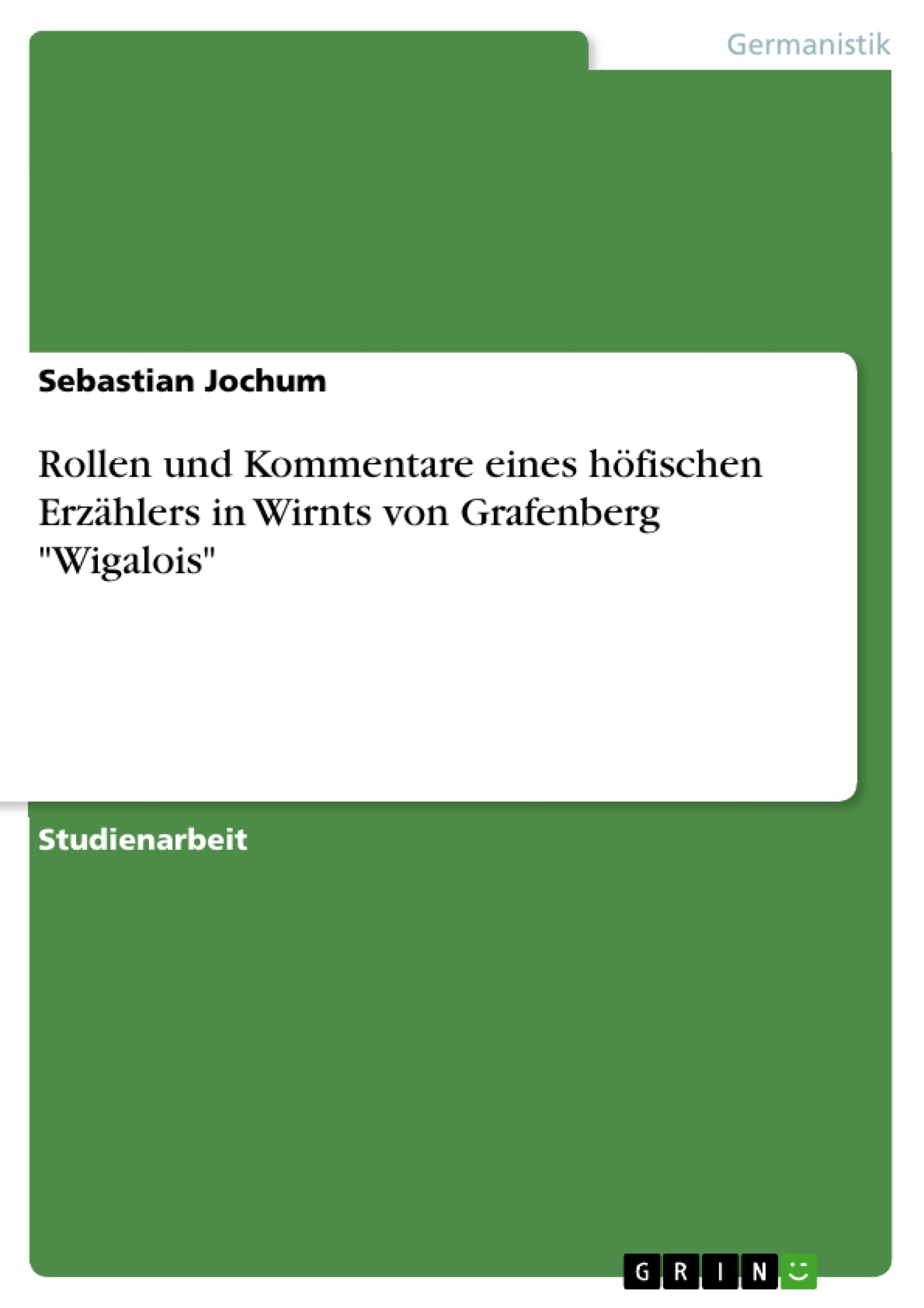Wer hât mich guoter ûf getân?
sî ez iemen der mich kan
beidiu lesen und verstên,
der sol genâde an mir begên,
ob iht wandels an mir sî,
daz er mich doch lâze vrî
valscher rede: daz êret in
(v. 1-7 ).
Den Prolog zu dem um 1210/20 entstandenen Artusroman Wigalois1 scheint nicht die Stimme des Autors oder Erzählers zu eröffnen, oder etwa einer Figur der Erzählung – vielmehr kommt diese Aufgabe dem Buch selbst zu, das die Leserschaft auffordernd anspricht. Wirnt von Grafenberg, Autor des mittelhochdeutschen Versepos, nimmt hier bereits zu Beginn literarische Techniken und Perspektiven vor, die seine Rolle als Verfasser auf eine aktive Ebene setzen, die stark mit der Erzählung verwoben ist. Bezeichnend für den Verlauf der Geschichte um den Titelhelden Gwîgâlois sind regelmäßige
subjektive Einschaltungen Wirnts, die der Gegenstand für die folgenden Untersuchungen sein sollen.
Dabei soll aufgezeigt werden, welche verschiedenen Rollen Wirnt annimmt, und in welchen erzählerischen Kontexten diese in Erscheinung treten. Den zentralen Fokus der vorliegenden Arbeit nehmen die Erzählerkommentare Wirnts ein, deren formale sowie inhaltliche und intentionale Aspekte voneinander abgegrenzt und erläutert werden sollen.
Inhalt
1. Einleitung
2. Erzählerrollen Wirnts von Grafenberg
3. Die Erzählerkommentare im Wigalois
3.1 Reflexionen
3.1.1 Frouwen und minne
3.1.2 Geistliche Kommentare
3.1.3 Zeitklagen
3.1.4 Weitere Tugenden und Weisheiten
3.2 Sentenzen
4. Fazit
Literaturverzeichnis